Urkundenbuch zur Geschichte der Herzöge von Braunschweig und Lüneburg und ihrer Lande bis zum Jahre 1341, Nr. 656, S. 465
Urkundenbuch zur Geschichte der Herzöge von Braunschweig und Lüneburg und ihrer Lande bis zum Jahre 1341, Nr. 656, S. 465
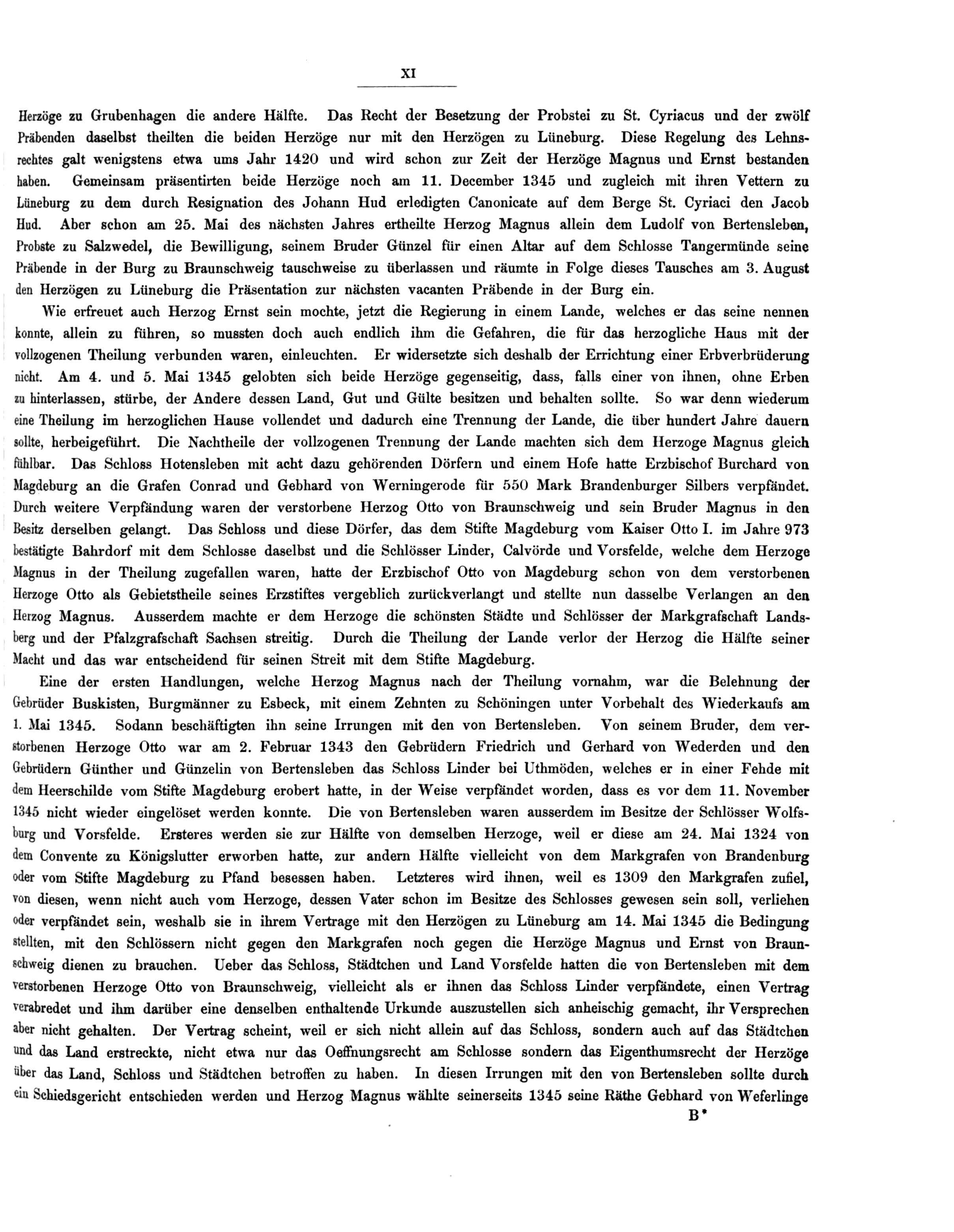
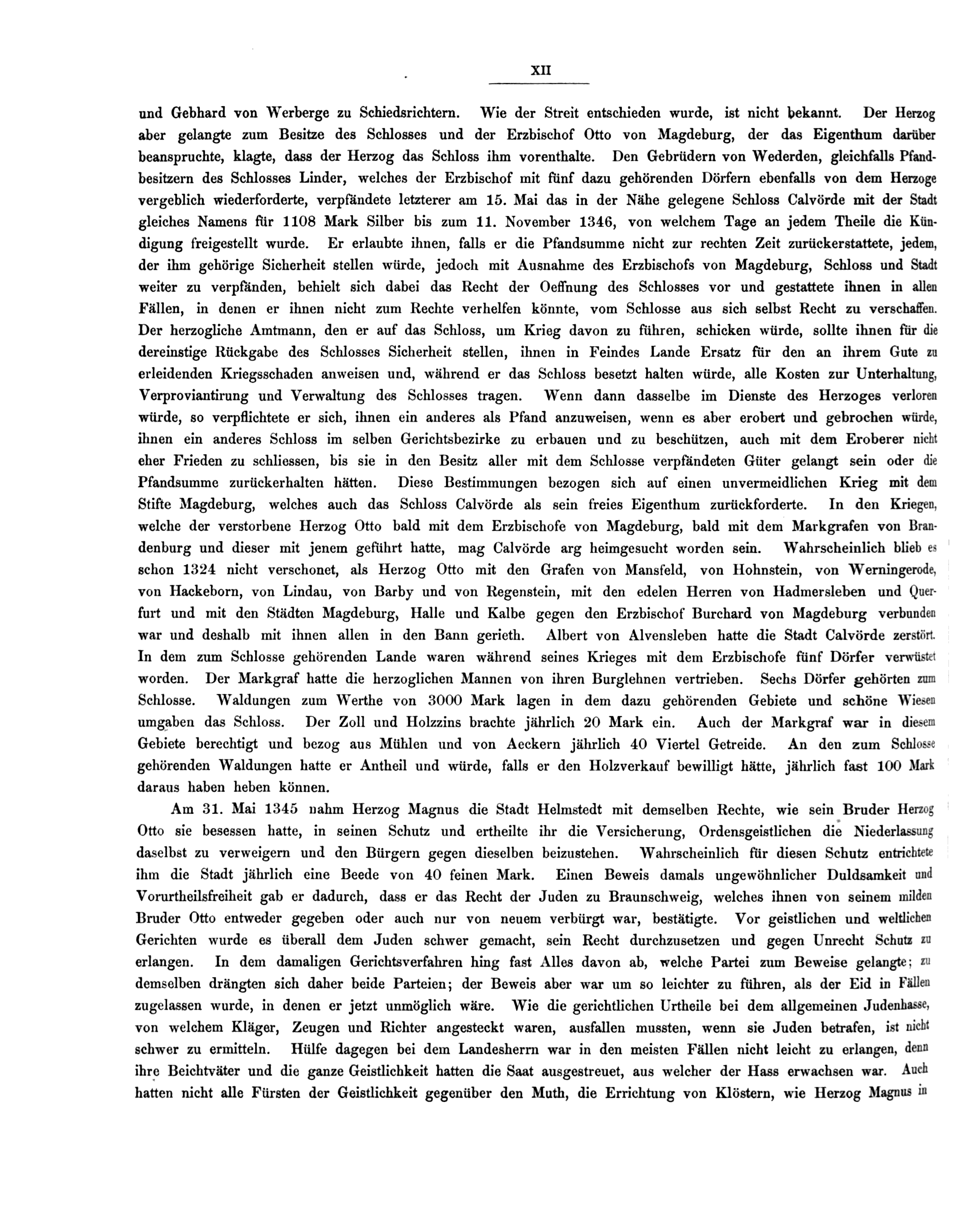


Urkundenbuch zur Geschichte der Herzöge von Braunschweig und Lüneburg und ihrer Lande bis zum Jahre 1341, Nr. 656, S. 465
B*
XII
und Gebhard von Werberge zu Schiedsrichtern. Wie der Streit entschieden wurde, ist nicht bekannt. Der Herzog aber gelangte zum Besitze des Schlosses und der Erzbischof Otto von Magdeburg, der das Eigenthum darüber beanspruchte, klagte, dass der Herzog das Schloss ihm vorenthalte. Den Gebrüdern von Wederden, gleichfalls Pfand besitzern des Schlosses Linder, welches der Erzbischof mit fünf dazu gehörenden Dörfern ebenfalls von dem Herzoge vergeblich wiederforderte, verpfändete letzterer am 15. Mai das in der Nähe gelegene Schloss Calvörde mit der Stadt gleiches Namens für 1108 Mark Silber bis zum 11. November 1346, von welchem Tage an jedem Theile die Kün digung freigestellt wurde. Er erlaubte ihnen, falls er die Pfandsumme nicht zur rechten Zeit zurückerstattete, jedem, der ihm gehörige Sicherheit stellen würde, jedoch mit Ausnahme des Erzbischofs von Magdeburg, Schloss und Stadt weiter zu verpfänden, behielt sich dabei das Recht der Oeflnung des Schlosses vor und gestattete ihnen in allen Fällen, in denen er ihnen nicht zum Rechte verhelfen könnte, vom Schlosse aus sich selbst Recht zu verschaffen. Der herzogliche Amtmann, den er auf das Schloss, um Krieg davon zu führen, schicken würde, sollte ihnen für die dereinstige Rückgabe des Schlosses Sicherheit stellen, ihnen in Feindes Lande Ersatz für den an ihrem Gute zu erleidenden Kriegsschaden anweisen und, während er das Schloss besetzt halten würde, alle Kosten zur Unterhaltung, Verproviantirung und Verwaltung des Schlosses tragen. Wenn dann dasselbe im Dienste des Herzoges verloren würde, so verpflichtete er sich, ihnen ein anderes als Pfand anzuweisen, wenn es aber erobert und gebrochen würde, ihnen ein anderes Schloss im selben Gerichtsbezirke zu erbauen und zu beschützen, auch mit dem Eroberer nicht eher Frieden zu schliessen, bis sie in den Besitz aller mit dem Schlosse verpfändeten Güter gelangt sein oder die Pfandsumme zurückerhalten hätten. Diese Bestimmungen bezogen sich auf einen unvermeidlichen Krieg mit dem Stifte Magdeburg, welches auch das Schloss Calvörde als sein freies Eigenthum zurückforderte. In den Kriegen, welche der verstorbene Herzog Otto bald mit dem Erzbischofe von Magdeburg, bald mit dem Markgrafen von Bran denburg und dieser mit jenem geführt hatte, mag Calvörde arg heimgesucht worden sein. Wahrscheinlich blieb es schon 1324 nicht verschonet, als Herzog Otto mit den Grafen von Mansfeld, von Hohnstein, von Werningerode, von Hackeborn, von Lindau, von Barby und von Regenstein, mit den edelen Herren von Hadmersleben und Quer furt und mit den Städten Magdeburg, Halle und Kalbe gegen den Erzbischof Burchard von Magdeburg verbunden war und deshalb mit ihnen allen in den Bann gerieth. Albert von Alvensleben hatte die Stadt Calvörde zerstört. In dem zum Schlosse gehörenden Lande waren während seines Krieges mit dem Erzbischofe fünf Dörfer verwüstet worden. Der Markgraf hatte die herzoglichen Mannen von ihren Burglehnen vertrieben. Sechs Dörfer gehörten zum Schlosse. Waldungen zum Werthe von 3000 Mark lagen in dem dazu gehörenden Gebiete und schöne Wiesen umgaben das Schloss. Der Zoll und Holzzins brachte jährlich 20 Mark ein. Auch der Markgraf war in diesem Gebiete berechtigt und bezog aus Mühlen und von Aeckern jährlich 40 Viertel Getreide. An den zum Schlosse gehörenden Waldungen hatte er Antheil und würde, falls er den Holzverkauf bewilligt hätte, jährlich fast 100 Mark daraus haben heben können.
Am 31. Mai 1345 nahm Herzog Magnus die Stadt Helmstedt mit demselben Rechte, wie sein Bruder Herzog Otto sie besessen hatte, in seinen Schutz und ertheilte ihr die Versicherung, Ordensgeistlichen die Niederlassung daselbst zu verweigern und den Bürgern gegen dieselben beizustehen. Wahrscheinlich für diesen Schutz entrichtete ihm die Stadt jährlich eine Beede von 40 feinen Mark. Einen Beweis damals ungewöhnlicher Duldsamkeit und Vorurtheilsfreiheit gab er dadurch, dass er das Recht der Juden zu Braunschweig, welches ihnen von seinem milden Bruder Otto entweder gegeben oder auch nur von neuem verbürgt war, bestätigte. Vor geistlichen und weltlichen Gerichten wurde es überall dem Juden schwer gemacht, sein Recht durchzusetzen und gegen Unrecht Schutz zu erlangen. In dem damaligen Gerichtsverfahren hing fast Alles davon ab, welche Partei zum Beweise gelangte; zu demselben drängten sich daher beide Parteien; der Beweis aber war um so leichter zu führen, als der Eid in Fällen zugelassen wurde, in denen er jetzt unmöglich wäre. Wie die gerichtlichen Urtheile bei dem allgemeinen Judenhasse, von welchem Klüger, Zeugen und Richter angesteckt waren, ausfallen mussten, wenn sie Juden betrafen, ist nicht schwer zu ermitteln. Hülfe dagegen bei dem Landesherrn war in den meisten Fällen nicht leicht zu erlangen, denn ihre Beichtväter und die ganze Geistlichkeit hatten die Saat ausgestreuet, aus welcher der Hass erwachsen war. Auch hatten nicht alle Fürsten der Geistlichkeit gegenüber den Muth, die Errichtung von Klöstern, wie Herzog Magnus ш
XIII
Braunschweig und Helmstedt, zu untersagen, viel weniger den verhassten Juden gerecht zu werden. Ehre deshalb dem frommen Herzoge Magnus! Er bestätigte die Verfügung seines Bruders Otto, dass alle Klagen gegen Juden, mochten sie von Juden oder Christen kommen, nur vor der Synagoge erhoben werden sollten, „denn", sprach er öffentlich aus, „vor der Synagoge haben die Juden ein besseres Recht, der Anschuldigung zu entgehen, als irgend ein anderer, Schuld auf sie zu bringen." Allerdings mochte vor dem Gerichte in der Synagoge wohl mancher der ihm gebührenden Strafe entgehen, aber unendlich mehr Unschuldige wurden vor ungerechter Strafe bewahrt. Eine jährliche Beede scheint die einzige Abgabe gewesen zu sein, die der Herzog von der Judenschaft zu Braunschweig erhob. Ein Jude, Namens Jordan von Helmstedt, der vom Herzoge Magnus am 15. Mai 1345 grösseren Schutz und wichtigere Begünstigungen als die übrigen Juden erlangte, entrichtete für sich und seine ganze Familie nur zwei Mark löthigen Silbers jährlicher Abgabe, worin die jährliche Beede eingerechnet war. Der Herzog gestattete ihm, zu Braunschweig zu wohnen, nahm ihn in seinen Frieden, versprach, vor seinem Bruder, dem Herzoge Ernst, ihn gegen Gewalt und Unrecht zu schützen, und stellte es dabei seinem Bruder anheim, ob er mit ihm jene Abgabe theilend, dem Juden denselben Schutz verleihen wollte. Auch gegen die Herzöge grubenhagenscher Linie, die wohl gleiches Recht, wie sie beide, über die Stadt Braunschweig besessen, versprach er Schutz und ertheilte dem Juden und dessen Nachkommen die Zusicherung, dass er ihnen kein Hindeiniss bereiten, sondern ihnen förderlich sein wollte, falls sie beabsichtigten, aus Braunschweig wegzuziehen. Am 6. December 1346 versicherte er sämmtliche Juden zu Braunschweig seines Schutzes und gelobte, sie bei ihrem Rechte zu vertheidigen und zu erhalten. Um von dem Einzelnen und von der ganzen Genossenschaft, wenn ein Jude in den Ruf, ein Verbrechen begangen zu haben, gerieth oder dessen angeschuldigt wurde, ungerechte Gewalt abzuwehren, verfügte er nach deshalb vorher mit der Judenschaft gepflogener Verhandlung am 27. März 1349, dass ein Jude wegen eines Verbrechens nur dann bestraft werden sollte, wenn er entweder durch zwei unbescholtene Christen und durch zwei unbescholtene Juden desselben überführt oder auf frischer That ergriffen würde, und dass in beiden Fällen die andern Juden sein Ver brechen nicht entgelten sollten. Um das Recht, welches von herzoglichen Vögten damals nur zu oft gebeugt wurde, zu schützen und Gerechtigkeit desto sicherer zu handhaben, Hess er nicht selten die streitigen Parteien vor sich kommen und entschied selbst als Richter, wenn er den Streit nicht in Güte schlichten konnte. Auch wo es sich darum handelte, späteren Streitigkeiten unter Unterthanen durch urkundliches Zeugniss vorzubeugen, hielt er es nicht für zu gering, selbst die Urkunde auszustellen. Freibriefe seinen aus der Leibeigenschaft entlassenen Leuten aus zustellen, überliese er nicht seinen Vögten oder Meiern, sondern er selbst bescheinigte ihnen ihre Freiheit und ihre Berechtigung, zu kaufen, zu verkaufen, zu verschenken, Verträge zu schliessen, vor Gericht zu stehen, Weihen zu empfangen und Testamente zu errichten, wie andere Freien. Er selbst stellte am 11. November 1345 dem Pfarrer zu Oelper, einem der herzoglichen Capellane, welcher, wie es scheint, eine Reise zu unternehmen hatte, am 15. Juni 1346 seinem Diener Hermann von Sassenhausen und am 12. November 1349 seinem Capellán und besonderen Diener, dem Dechanten der Kirche St. Simonis et Judae zu Goslar, ein Schutz- und Empfehlungsschreiben aus, welches bei weiten Reisen, wie später der Pass, ein unentbehrlicher Begleiter war. So wollte der Herzog überall selbst sehen, hören und helfen. Den befreundeten Nachbarfürsten stand er in Gefahren zur Seite. So eilte er dem mit ihm nahe verwandten Markgrafen Ludwig gegen den König von Böhmen zu Hülfe, kam am 4. Juli 1345 in Berlin an, um die Mark gegen die Böhmen zu vertheidigen, und zog, als die Gefahr vorüber war, am 18. desselben Monats in sein Herzogthum zurück, wo drohende Kriege seine Gegenwart erforderten. In der Liebe seiner Unterthanen und in der Achtung der übrigen Reichsfürsten und des Kaisers fand er die Belohnung für die Sorgfalt, die er ersteren widmete, und für die Dienste, die er letzteren leistete. Ein Zeichen besonderer Achtung und Vertrauens gab ihm Kaiser Ludwig, indem er ihn beauftragte, den Bischof Heinrich von Merseburg mit den Reichslehnen dieses Stiftes zu belehnen. Herzog Magnus entledigte sich dieses Auftrages am 9. October 1345.
Obgleich Herzog Magnus aller seiner Hülfsquellen, so weit sie nicht für die Verwaltung des Landes in Anspruch genommen wurden, zur Bestreitung der Kosten unabweislicher kriegerischer Unternehmungen bedurfte, so liess er doch nicht die Gelegenheit ungenutzt vorübergehen, sich am 6. August 1345 auf mindestens vier Jahre in den Pfandbesitz des Dorfes Rorsheim von dem Grafen Heinrich von Regenstein für 200 löthige Mark setzen zu lassen, weil dabei durch
XIV
Urkundenbuch Braunschweig und Lüneburg, ed. Sudendorf, 1859 (Google data) 656, in: Monasterium.net, URL <https://www.monasterium.net/mom/BraunschweigLueneburg/c6820061-c20d-4b22-bee3-be95c21ff21c/charter>, accessed 2025-04-17+02:00
The Charter already exists in the choosen Collection
Please wait copying Charter, dialog will close at success