Charter: Tobias, Carl Anton: Regesten des Hauses Schoenburg, 1865 (Google data) 18
Signature: 18
The transcription and metadata of this charter are scanned by a OCR tool and thus may have low quality.
Add bookmark
Edit charter (old editor)
99999999
1261: Friedrich von Schönburg (Schonenburch) übergibt mit Einwilligung seiner
Kinder Hermann, Friedrich, Dietrich und Friedrich dem Nonnenkloster in Gerings walde die
peinliche Gerichtsbarkeit, den Blutbann, an allen demselben zustehenden Orten der
Umgegend, welche bisher unter seiner Gerichtsbarkeit sich befanden. Diese Urkunde ist von
hoher Wichtigkeit für die Geschichte des Hauses Schönburg, weil sie zeigt, welche grosse
Rechte ihm gehörten. Der Blutbann, oder die Gerichtsbarkeit über Hals und Hand, galt um
das J. 1000 als mit der geistlichen Würde und dem Grundsatze, ecelesia non sitit
sanguinem, unvereinbar. In mehreren fürstlichen Wappen, z. B. im sächsischen und
brandenburgischen ist dieses ursprünglich wichtigste Regal durch ein besonderes, einfach
rothes Feld angedeutet, sowie auch ehemals bei solennen Aufzügen neben den Fahnen mit den
Wappen der Provinzen eine rothe, die Blutfahne genannt, figitrirte. (Lepsius 10, 1.37).
Das Augustmer- kloster zu Altenburg erhielt bei seiner Gründung, die jedenfalls kurz vor
der Gründung des Klosters Geringswalde erfolgte, 1172, ebenfalls vom Kaiser Friedrich
eigene unbeschränkte Juris diction, mit Etnschluss des Blutbannes, per omuem proprietatem
suam judicium vitae et necis. und wurde von aller weltlichen Gerichtsbarkeit eximiit,
indem der Kaiser die Advocatie über das Kloster, dessen Personen und Besitzungen sich
selbst und dem Reiche und zwar mit der Zusi cherung vorbehielt, dass dieselbe nie an
irgend Jemand verliehen werden solle. (Leps. S. 57). Sollte nicht dieses Beispiel
Veranlassung für Friedrich von Schönburg geworden sein, ähnliche Freiheiten seiner
Stiftung zu widmen, da ihm theils durch die benachbarte Lage, theils durch diesem Kloster
«remachte Schenkungen die Verhältnisse bekannt waren? Einige wollen sogar im Namen
Schönburg. Scoimcburg, Sconcburch und, wie man hchnuptet, gleich den Schön- bergen,
Skonowe geheissen, wns von dem slawischen skon, das Lebensende, stammend, eine Andeutung
auf das Recht über Leben und Tod enthält, die Bedeutung eines Dynasten erblicken, was
schliesslich Anfangs gar kein Name, sondern nur Bezeichnung einer Würde gewesen sein soll,
ähnlich wie Kochlitz und Kochsburg von rok, ulas Unheil, der Spruch, also Unheilsburg,
Ortenburg. Zum ersten Male wird in dieser Urkunde der Stadt (opidum) Geringswalde gedacht,
welche 1233 noch eine wüste Stadt (opidum desolatnm) genannt wurde. Von besonderem
Interesse jedoch sind uns die Zeugen: Conradus de horla miles, R de musella, II. plebanus
in gluchow, Jo. plebanus in Lictinsten. Die beiden erswren sind Schönburgische Vasallen.
In der beim J. 1233 erwähnten Handschrift werden die milites de musella als ursprünglich
mit den Schön- burgern in diese Lande gekommen und als diejenigen bezeichnet, deren
Nachkommen noch leben. Sic erhielten als Lehen die Rittergüter Mosel, zwischen Glauchau
und Zwickau, welche auch bis zum Ende des 18. Jahrhunderts in dieser Fa milie blieben (s.
Einleitung, Krölmc dipl. G. f. 85 und Stöckh. I. 8). Zu derselben Familie gchört auch
jener Lutoldus miles dominus de musella, dessen nachgelassene Aecker und Wald im Jahre
1288 dem Kloster Gcringswalde bestätigt wurden, sowie Henricus frater und Henricus et
Johannes filii Rheinbotenis de Musella, welche Zinsen in Weissenborn hei Zwickau dem
Kloster Grünhain 1324 schenken, wegen welcher sie ebenfalls Schönburgische Lehensträger
waren. Derselbe Henricus filius Reinboti verkauft abermals 1342 eine Hufe in Weissenborn
demselben Kloster. Lutoldus de Mosela ist 1262 den 1. März Zeuge unter einer Merseburger
Urkunde, ein gleichnamiger miles der Herren von Colditz in Nossen 1320 den 11. März (cod.
dipl. Snx. reg. II, 1. nr. 191). Conrad von der Mosele wird 1443 erwähnt (Sch. und Kr.
sei-. II, 521) u. s. w. Die letztern beiden obigen Zeugen sind die ersten Geistlichen, die
wir aus den Schönburgischen Städten Glauchau und Lichtenstein kennen. Sie treten abermals
1288 auf. Als Ausstellungsort wird Glauchau, gluchow, genannt, ebenfalls zum eisten Male,
so dass sich der Besitz dieses Ortes in der Familie Schönburg über 600 Jahre zurück
datirt. Glauchau ist wahrscheinlich unter Heinrich I., im Anfang des 10. Jahrhunderts
gegen die Sorbenwenden angelegt, die erst 10K7 vom König Vratislav von Böhmen besiegt und
unter worfen worden sein sollen. Immerhin bleibt es eine Stammbesitzung der Schönburger
und wird ihnen für ihre Dienste im Kriege als kaiserliches Geschenk verliehen worden sein.
Wenn allerdings Schuhes (dir. dipl. I, 6) sagt, dass bereits im J. 786 Kaiser Karl der
Grosse dem Ritter Ludwig tlem Aeltern, seinem obersten General, sowie dessen Erben als
Belohnung einen grossen Land strich, desgleichen die Städte Glichau und Aschke mit Zubchör
geschenkt habe und im Register unter Glichau unser Glauchau gemeint ist, so ist das ein
Irrthum, da zu seinen Zeiten nicht ein mal die Burg Gluchowe stand, nicht zu gedenken der
Stadt, die viele Jahrhunderte später und 16 zuerst in der Nähe des Schlosses sich bildete.
Andere wollen wissen, dass das Schloss in Glauchau in alten Zeiten die schöne Burg
geheissen habe und das Schönburgische Hauptstammhaus sei, aber auch diese Behauptungen
bedürfen erst weiterer Bestätigung. Das Schloss lag damals in dem grossen Walde, der
Miriquidi oder Miriquido hiess und bis in die Gegend von Rochlitz und Colditz reichte,
nemus quod est inter Daleminciam et Bohemiam. Vor dem 13. Jahrhundert war diese ganze
Gegend undurchdringlicher Wald. Die ersten Anbaucr sind Sachsen und Franken ge wesen,
indem die Sachsen sich von Sachsenburg bis Döbeln, die Franken aber um Frankenberg herum
ansiedelten. Du» Original dieser Urkunde auf Pergament besitzt die deutsche Ges. zu
Leipzig. An rothscidenen Fäden hangt i'in Bruchstück eines ovalen Wachssicgels mit den
noch kennbaren Ucberresten eines Schragbalkens und den Buchstaben . . . DES ...
Abgedi-uekt verbessert in der Mitth. der deutsch. Ges. I, 1. S. 146, vorher bei Beruh. S.
54. V. G. A. N. 3. S. Kreys. Beitr. VI, 17. KrChnc Dipl. B. setzt die Urkunde fälschlich
in das J. 1291. Als 12t51 den 15. Juli Markgraf Albert von Meissen und seine Gemahlin
Margaretha den Brüdern des deutschen Hauses zu Altenburg alle Rechte, die sie auf die
Wälder um Alten- fcurg von den Kaisern Heinrich und Friedrich erhalten haben, bestätigen,
erscheint als Zeuge in Altenburg: Guntherus de Crimaschowe (Crimitschau), Fridericus de
Sconenburc ete. Orig. Urk. im Hpt.St.A. Dresden nr. 606. Dat. Id. Jul.. Ind. V. Source Regest:
Regesten des Hauses Schönburg vom urkundlichen Auftreten desselben bis zum Jahre 1326, Nr. 18, S. 27
Regesten des Hauses Schönburg vom urkundlichen Auftreten desselben bis zum Jahre 1326, Nr. 18, S. 27
Current repository:
Regesten des Hauses Schönburg vom urkundlichen Auftreten desselben bis zum Jahre 1326, Nr. 18, S. 27
Regesten des Hauses Schönburg vom urkundlichen Auftreten desselben bis zum Jahre 1326, Nr. 18, S. 27
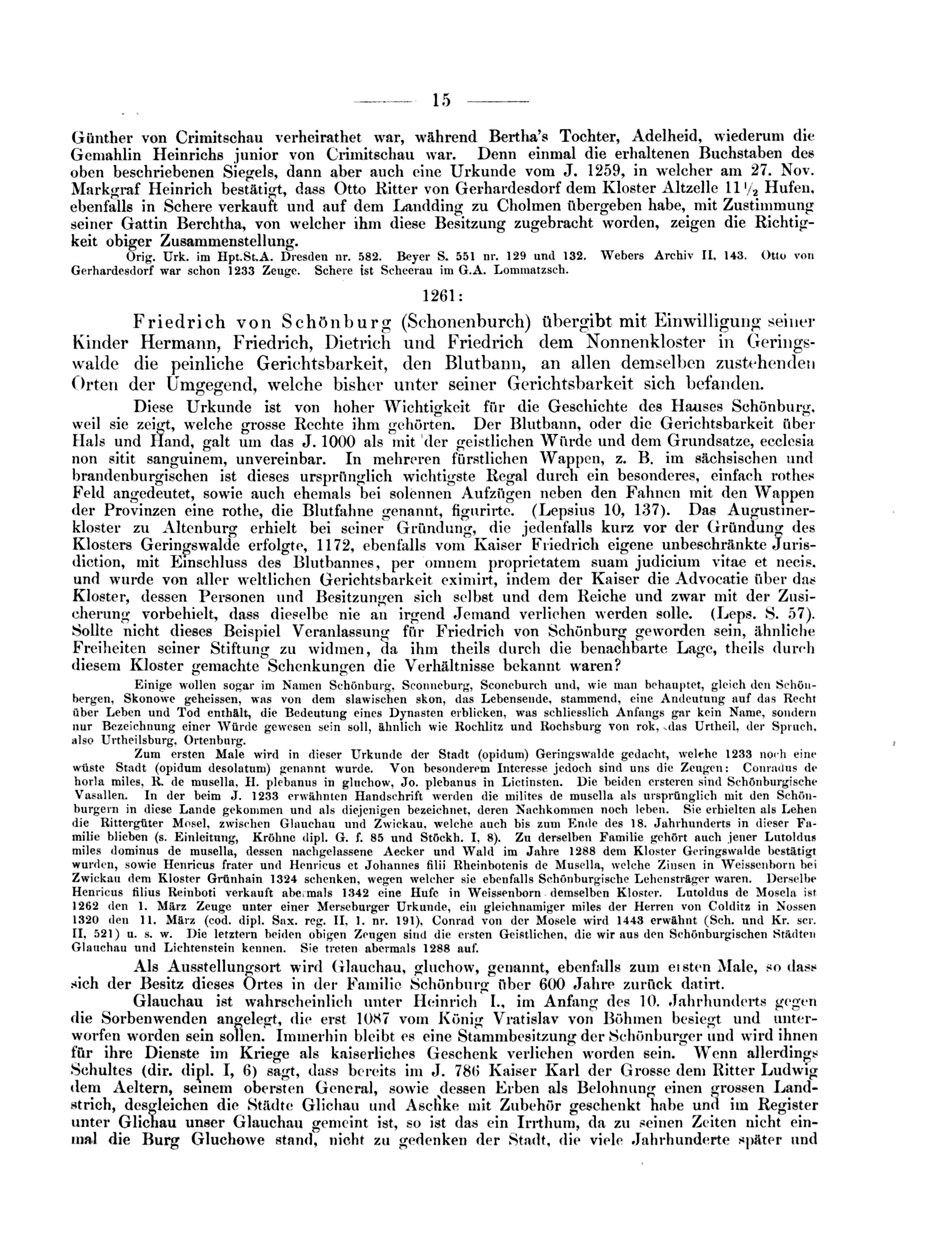
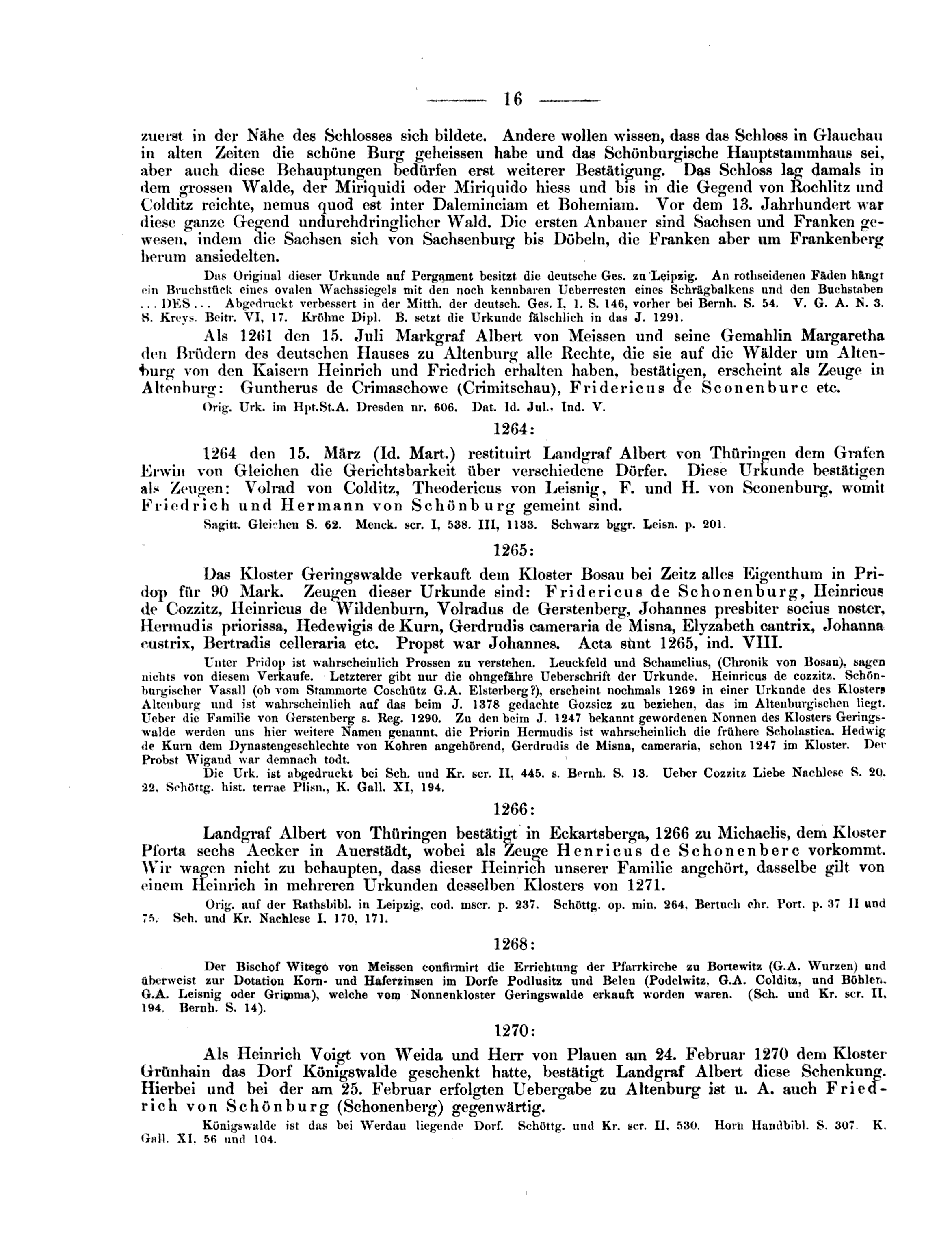
Tobias, Carl Anton: Regesten des Hauses Schoenburg, 1865 (Google data) 18, in: Monasterium.net, URL <https://www.monasterium.net/mom/HausesSchoenburg/9db63685-819c-4b20-81d1-1c252f39f488/charter>, accessed 2025-04-15+02:00
You are copying a text frominto your own collection. Please be aware that reusing it might infringe intellectural property rights, so please check individual licences and cite the source of your information when you publish your data
The Charter already exists in the choosen Collection
Please wait copying Charter, dialog will close at success