Meklenburgisches Urkundenbuch - Band I -, Nr. 241, S. 295
Meklenburgisches Urkundenbuch - Band I -, Nr. 241, S. 295
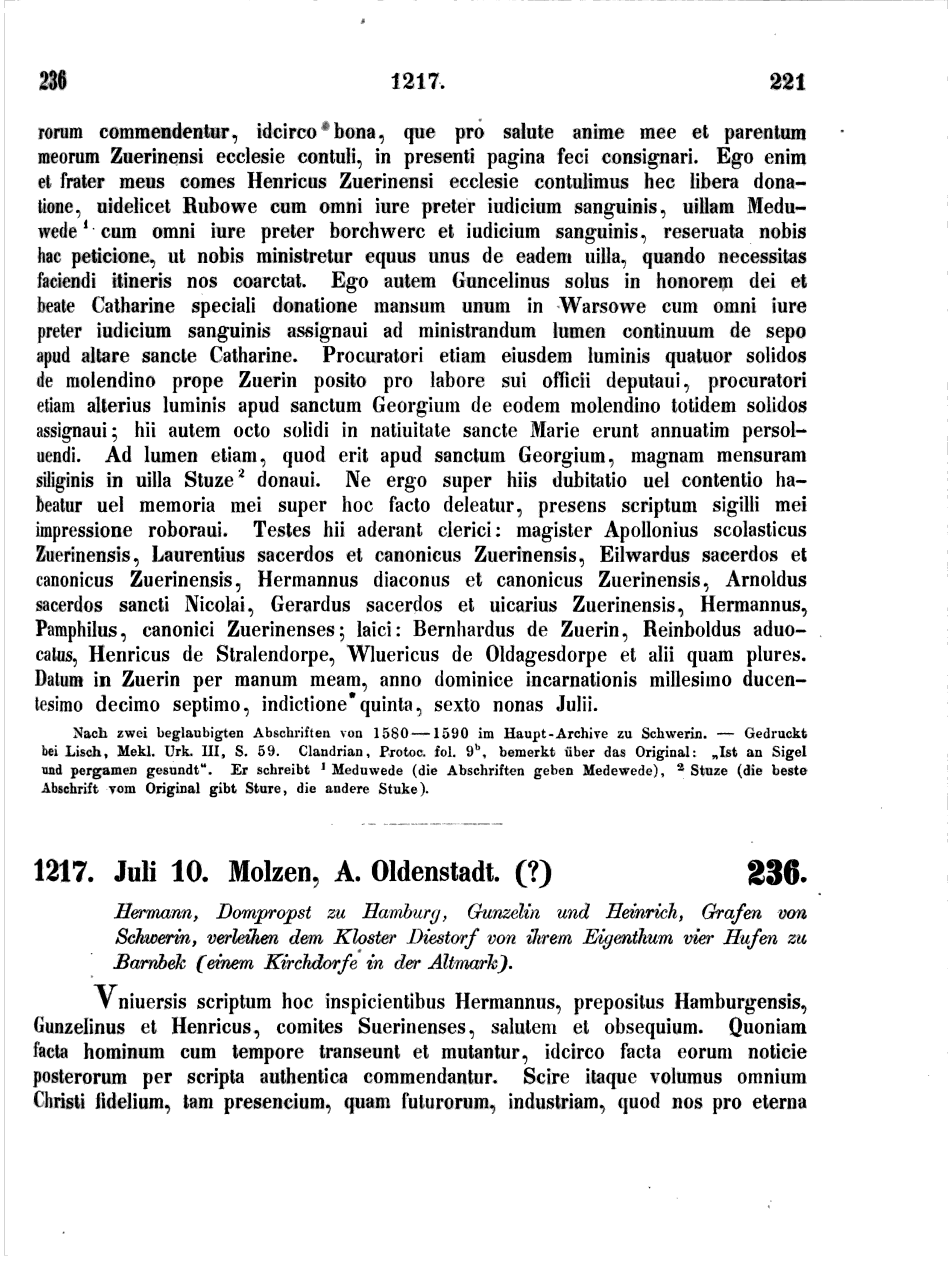
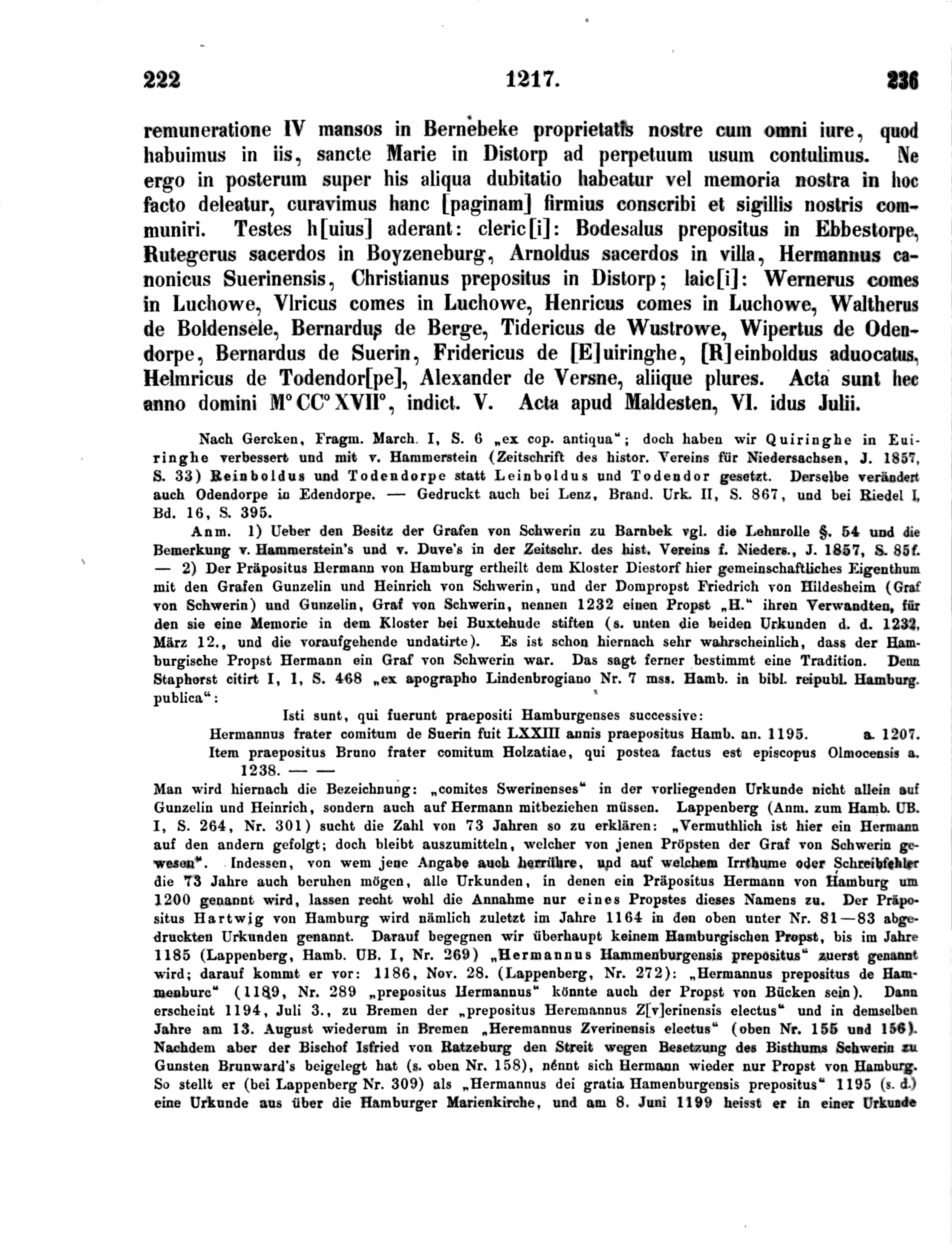
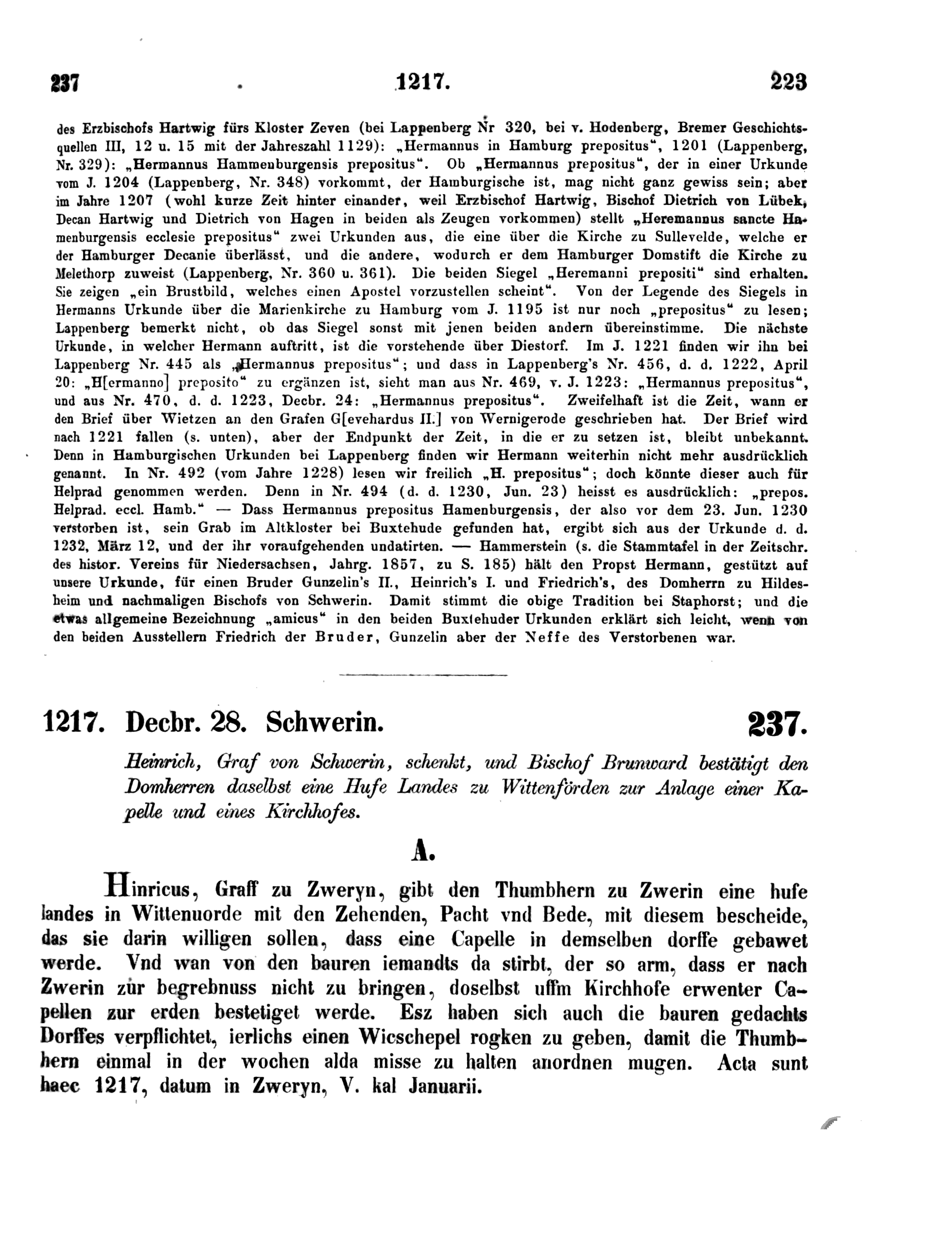
Meklenburgisches Urkundenbuch - Band I -, Nr. 241, S. 295
Vniuersis scriptum hoc inspicientibus Hermannus, prepositus Hamburgensis, (junzelinus et Henricus, comiles Suerinenses, salulem et obsequium. Quoniam facta hominum cum tempore transeunt et mutantur, idcirco facta eorum noticie posterorum per scripla authentica commendantur. Scire itaque volumus omnium Christi iidelium, tarn presencium, quam futurorum, industriam, quod nos pro eterna
222 1217. 236
remuneratione IV inansos in ßernebeke proprietatte nostre cum omni iure, quod habuimus in iis, sancte Marie in Distorp ad perpetuum usum contulimus. Ne ergo in posterura super bis aliqua dubitatio habeatur vel memoria nostra in hoc facto deleatur, curavimus hanc [paginam] firmius conscribi et sigillis nostris cora- muniri. Testes h[uius] aderant: cleric[i]: Bodesalus prepositus in Ebbestorpe, Rutegcrus sacerdos in Boyzeneburg, Arnoldus sacerdos in villa, Hermantius ca- nonicus Suerinensis, Christianus prepositus in Dislorp; laic[i]: Wernerus comes in Luchowe, Vlricus comes in Luchowe, Henricus comes in Luchowe, Waltherus de Boldensele, Bernardus de Berge, Tidericus de Wuslrowe, Wipertus de Oden- dorpe, Bernardus de Suerin, Fridericus de [EJuiringhe, [RJeinboldus aduocatus. Helmricus de Todendor[pe], Alexander de Versne, aliique plures. Acla sunl hec anno domini M°CC°XVli0, indict. V. Acta apud Maidesten, VI. idus Julii.
Nach Gercken, Fragiu. March I, S. C „ex cop. antiqua"; doch haben wir Quiringhe in Eui- ringhe verbessert und mit v. Hammerstein (Zeitschrift den histor. Vereins für Niedersachsen, J. 1857, S. 33) Reinboldus und Todendorpc statt Leinboldus und Todendor gesetzt. Derselbe verändert auch Odendorpe iu Edendorpe. — Gedruckt auch bei Lenz, Brand. Urk. II, S. 867, und bei Biedel . Bd. 16, S. 395.
A n m. 1) Ueber den Besitz der Grafen von Schwerin zu Barnbek Tgl. die Lehnrolle §. 54 und die Bemerkung T. Hammerstein's und v. Duve's in der Zeitschr. des bist. Vereins f. Nieder«., J. 1857, S. 85f. — 2) Der Präpositus Hermann von Hamburg ertheilt dem Kloster Diestorf hier gemeinschaftliches Eigenthum mit den Grafen Gunzelin und Heinrich von Schwerin, und der Dompropst Friedrich von Hildesheim (Graf von Schwerin) und Gunzelin, Graf von Schwerin, nennen 1232 einen Propst „H." ihren Verwandten, für den sie eine Memoric in dem Kloster bei Buxtehudc stiften (s. unten die beiden Urkunden d. d. 1233, März 12., und die voraufgehende undatirte). Es ist schon hiernach sehr wahrscheinlich, dass der Hau; burgisehe Propst Hermann ein Graf von Schwerin war. Das sagt ferner bestimmt eine Tradition. Denn Staphof st citirt I, l, S. 468 „ex apographo Lindenbrogiano Nr. 7 mss. Hamb. in bibl. retpubL Hamburg, publica":
Isti sunt, qui fuerunt pracpositi Hamburgenses successivc:
Hermannus frater comitum de Suerin fuit 1.XXIII annis praepositus Hamb. an. 1195. a. 1207.
Item praepositus Brnno frater comitum Holzatiae, qui postea factus est episcopus Olmocensis a.
1238.
Man wird hiernach die Bezeichnung: „comites Swerinenseg" in der vorliegenden Urkunde nicht allein auf Gunzelin und Heinrich, sondern auch auf Hermann mitbezichcn müssen. Lappenberg (A um. zum Hamb. (JB. I, S. 264, Nr. 301) sucht die Zahl von 73 Jahren so zu erklären: „Verrnuthlich ist hier ein Hermann auf den ändern gefolgt; doch bleibt auszumitteln, welcher von jenen Pröpsten der Graf von Schwerin ge- weson". Indessen, von wem jene Angabe auch herrühre, und auf welchem Irrthume oder Schreibfehler die 73 Jahre auch beruhen mögen, alle Urkunden, in denen ein Präpositus Hermann von Hamburg um 1200 genannt wird, lassen recht wohl die Annahme nur eines Propstes dieses Namens zu. Der Präpo situs Hartwig von Hamburg wird nämlich zuletzt im Jahre 1164 in den oben unter Nr. 81—83 abge druckten Urkunden genannt. Darauf begegnen wir überhaupt keinem Hamburgischen Propst, bis im Jahre 1185 (Lappenberg, Hamb. (JB. I, Nr. 269) „Hermannus Hammenburgensis prepositus" zuerst genannt wird; darauf kommt er vor: 1186, Nov. 28. (Lappenberg, Nr. 272): „Herniannus prepositus de Ha» • menburc" (118.9, Nr. 289 „prepositus Uermannus" könnte auch der Propst von Bücken sein). Dana erscheint 1194, Juli 3., zu Bremen der „prepositus Heremannus Z[v]erinensis electus" und in demselben Jahre am 13. August wiederum in Bremen „Heremannus Zverinensis electus" (oben Nr. 155 und 156). Nachdem aber der Bischof Isfried von Ratzeburg den Streit wegen Besetzung des Bisthums Schwerin zu Gunsten Brunward's beigelegt hat (s. oben Nr. 158), nennt sich Hermann wieder nur Propst von Hamburg. So stellt er (bei Lappenberg Nr. 309) als „Hermannus dei gratia Hamenburgensis prepositus" 1195 (s.d.) eine Urkunde ans über die Hamburger Marienkirche, und am 8. Juni 1199 heisst er in einer Urkunde
237 . 1217. 223
des Erzbischofs Hartwig fürs Kloster Zeven (bei Lappenberg Nr 320, bei y. Hodenborg, Bremer Geschichts quellen IH, 12 u. 15 mit der Jahreszahl 1129): „Hermannus in Hamburg prepositus", 1201 (Lappenberg, Nr. 329): „Hermannus Hammeuburgensis prepositus". Ob „Hermannas prepositus", der in einer Urkunde Tom J. 1204 (Lappenberg, Nr. 348) vorkommt, der Hamburgische ist, mag nicht ganz gewiss sein; aber im Jahre 1207 (wohl knrze Zeit hinter einander, weil Erzbischof Hartwig, Bischof Dietrich von Lübek, Decan Hartwig und Dietrich von Hagen in beiden als Zeugen vorkommen) stellt „Heremannus snncte Ha- menburgensis ecclesie prepositus" zwei Urkunden aus, die eine über die Kirche zu Süllevelde, welche er der Hamburger Decanie überlässt, und die andere, wodurch er dem Hamburger Dorastift die Kirche zu Melethorp zuweist (Lappenberg, Nr. 360 u. 361). Die beiden Siegel .,Heremanni prepositi" sind erhalten. Sie zeigen „ein Brustbild, welches einen Apostel vorzustellen scheint". Von der Legende des Siegels in Hermanns Urkunde über die Marienkirche zu Hamburg vom J. 1195 ist nur noch „prepositus" zu lesen; Lappenberg bemerkt nicht, ob das Siegel sonst mit jenen beiden andern übereinstimme. Die nächste Urkunde, in welcher Hermann auftritt, ist die vorstehende über Diestorf. Im J. 1221 finden wir ihn bei Lappenberg Nr. 445 als ^ßermannus prepositus"; und dass in Lappenberg's Nr. 456, d. d. 1222, April 20: „H[ermanno] preposito" zu ergänzen ist, sieht man aus Nr. 469, v. J. 1223: „Hermannus prepositus", und aus Nr. 470, d. d. 1223, Decbr. 24: „Hermannus prepositus". Zweifelhaft ist die Zeit, wann er den Brief über Wietzen an den Grafen G[evehardus IL] von Wernigerode geschrieben hat. Der Brief wird. nach 1221 fallen (s. unten), aber der Endpunkt der Zeit, in die er zu setzen ist, bleibt unbekannt. Denn in Hamburgischen Urkunden bei Lappenberg finden wir Hermann weiterhin nicht mehr ausdrücklich genannt. In Nr. 492 (vom Jahre 1228) lesen wir freilich „H. prepositus"; doch könnte dieser auch für Helprad genommen werden. Denn in Nr. 494 (d. d. 1230, Jun. 23) heisst es ausdrücklich: „prepos. Helprad. eccl. Hamb." — Dass Hermannus prepositus Hamenburgensis, der also vor dem 23. Jun. 1230 verstorben ist, sein Grab im Altkloster bei Buxtehude gefunden hat, ergibt sich aus der Urkunde d. d. 1232, März 12, und der ihr voraufgehenden undutirtcn. — Hamraerstein (s. die Stammtafel in der Zeitschr. des histor. Vereins für Niedersachsen, Jahrg. 1857, zu S. 185) hält den Propst Hermann, gestützt auf unsere Urkunde, für einen Bruder Gunzelin's IL, Heinrich's I. und Friedrich's, des Domherrn zu Hildes heim und nachmaligen Bischofs von Schwerin. Damit stimmt die obige Tradition bei Staphorst; und die «twju allgemeine Bezeichnung „amicus" in den beiden Buxl ehuder Urkunden erklärt sich leicht, wenn von den beiden Ausstellern Friedrich der Bruder, Gunzelin aber der Neffe des Verstorbenen war.
Meklenburgisches Urkundenbuch, 1863 (Google data) 241, in: Monasterium.net, URL <https://www.monasterium.net/mom/MeklenUrk/bbda36a5-950d-4cea-8cb4-da0fbd8e7204/charter>, accessed 2025-04-09+02:00
The Charter already exists in the choosen Collection
Please wait copying Charter, dialog will close at success