Urkundenbuch zur Geschichte der Herzöge von Braunschweig und Lüneburg und ihrer Lande bis zum Jahre 1341, Nr. 670, S. 493
Urkundenbuch zur Geschichte der Herzöge von Braunschweig und Lüneburg und ihrer Lande bis zum Jahre 1341, Nr. 670, S. 493
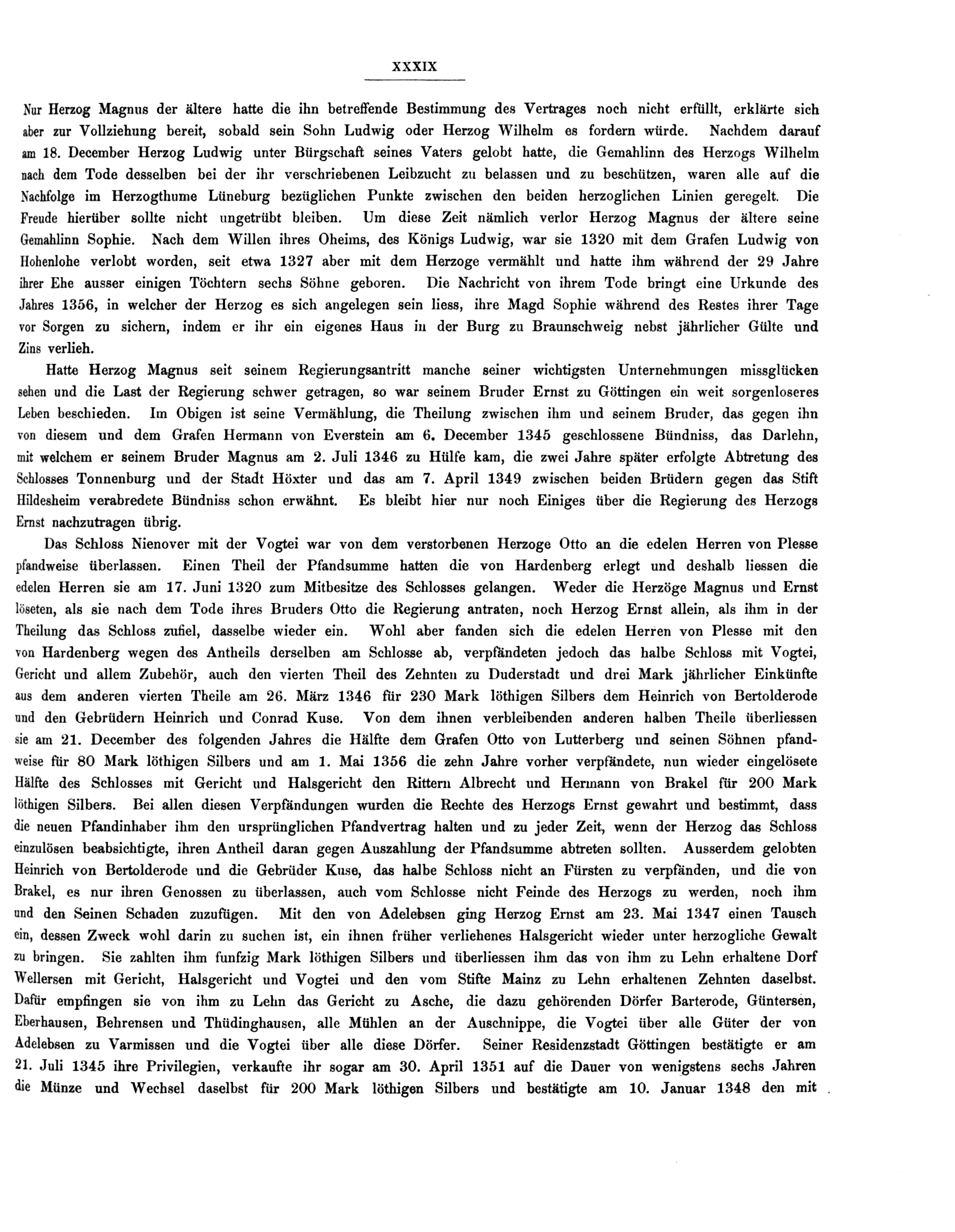
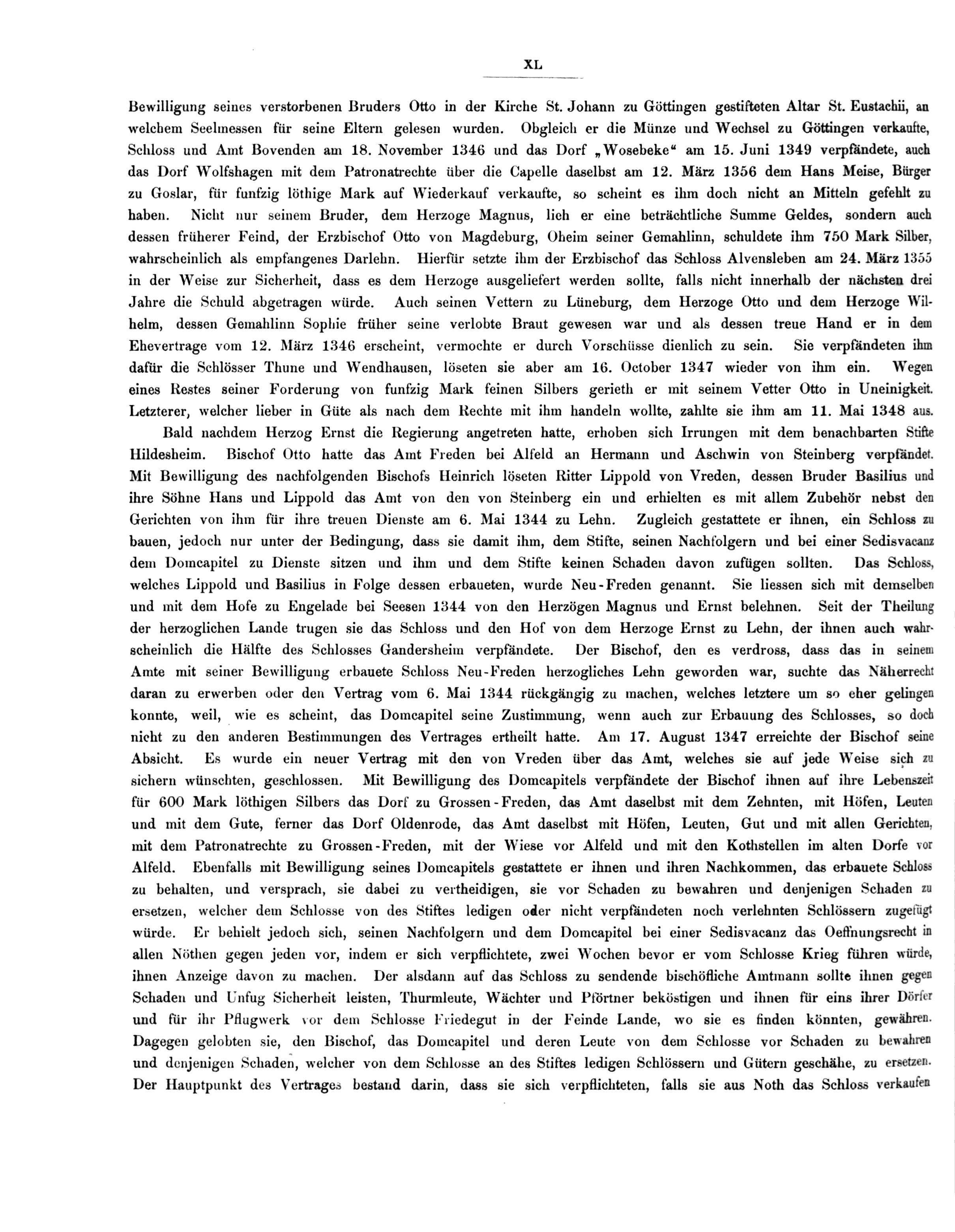
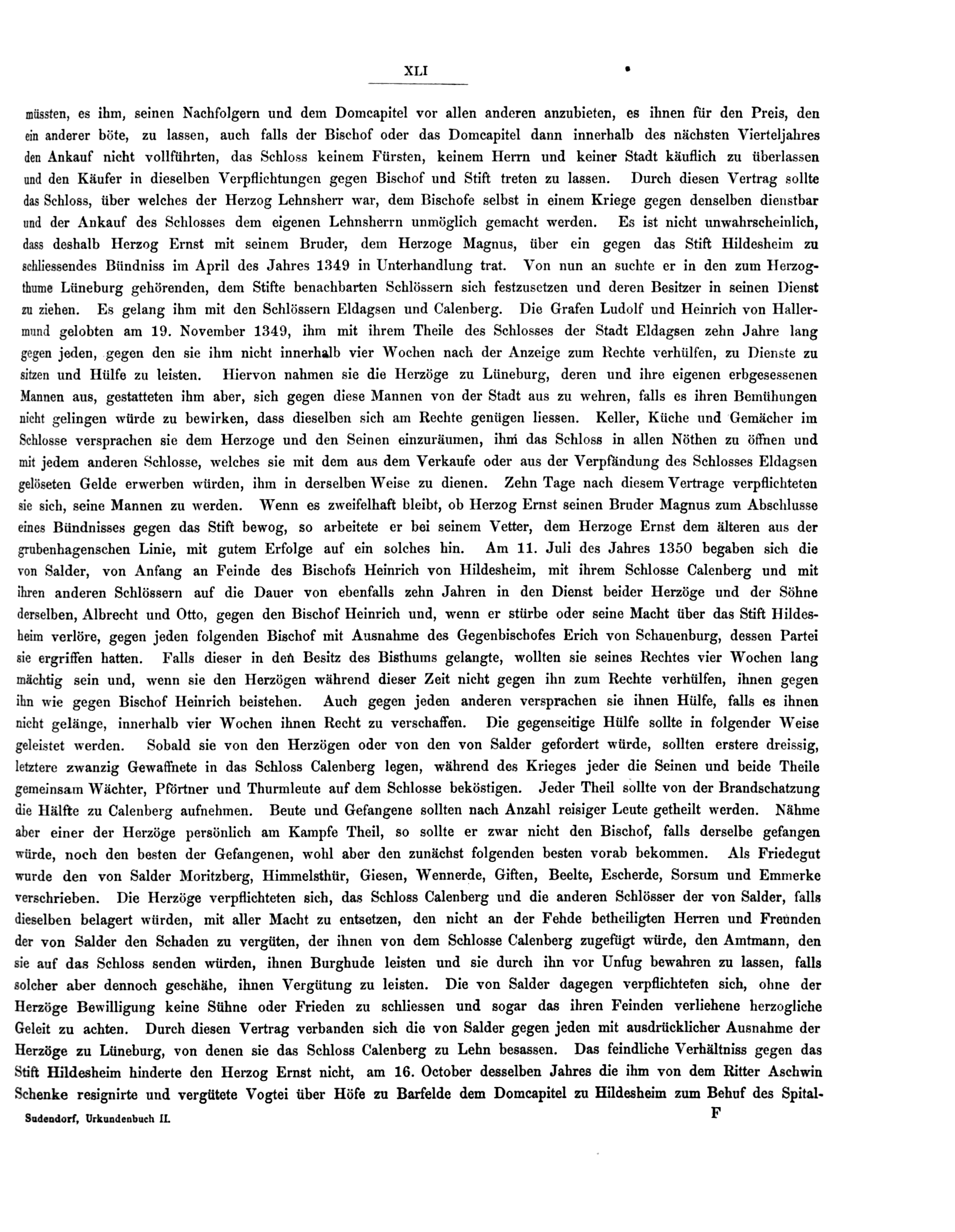
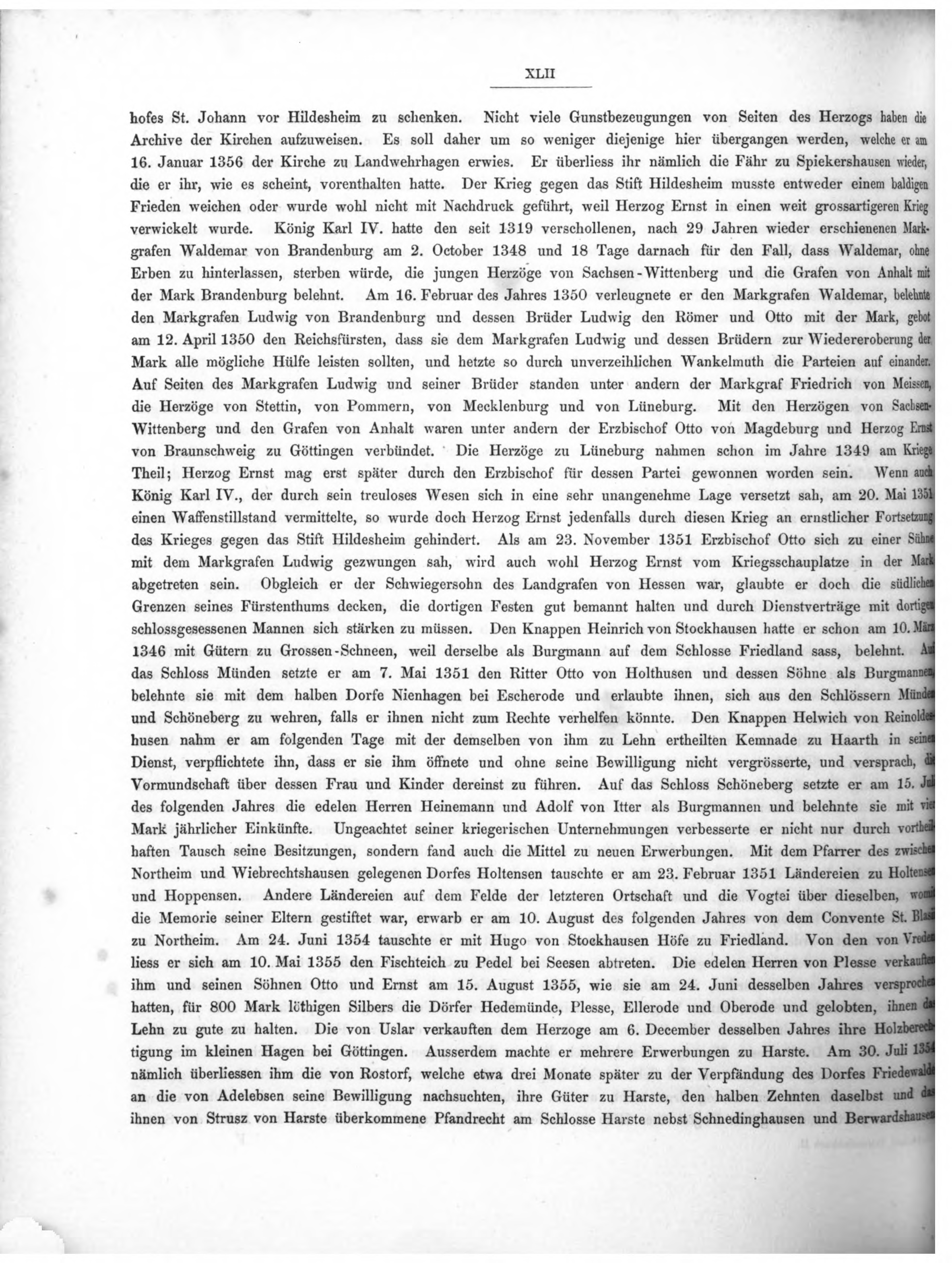
Urkundenbuch zur Geschichte der Herzöge von Braunschweig und Lüneburg und ihrer Lande bis zum Jahre 1341, Nr. 670, S. 493
XL
Bewilligung seines verstorbenen Bruders Otto in der Kirche St. Johann zu Göttingen gestifteten Altar St. Euetachii, an welchem Seelmessen für seine Eltern gelesen wurden. Obgleich er die Münze und Wechsel zu Göttingen verkaufte, Schloss und Amt Bovenden am 18. November 1346 und das Dorf „Wosebeke" am 15. Juni 1349 verpfändete, auch das Dorf Wolfshagen mit dem Patronatrechte über die Capelle daselbst am 12. März 1356 dem Hans Meise, Bürger zu Goslar, für fünfzig löthige Mark auf Wiederkauf verkaufte, so scheint es ihm doch nicht an Mitteln gefehlt zu haben. Nicht nur seinem Bruder, dem Herzoge Magnus, lieh er eine beträchtliche Summe Geldes, sondern auch dessen früherer Feind, der Erzbischof Otto von Magdeburg, Oheim seiner Gemahlinn, schuldete ihm 750 Mark Silber, wahrscheinlich als empfangenes Darlehn. Hierfür setzte ihm der Erzbischof das Schloss Alvensleben am 24. März 1355 in der Weise zur Sicherheit, dass es dem Herzoge ausgeliefert werden sollte, falls nicht innerhalb der nächsten drei Jahre die Schuld abgetragen würde. Auch seinen Vettern zu Lüneburg, dem Herzoge Otto und dem Hei-zoge Wil helm, dessen Gemahlinn Sophie früher seine verlobte Braut gewesen war und als dessen treue Hand er in dem Ehevertrage vom 12. März 1346 erscheint, vermochte er durch Vorschüsse dienlich zu sein. Sie verpfändeten ihm dafür die Schlösser Thune und Wendhausen, löseten sie aber am 16. October 1347 wieder von ihm ein. Wegen eines Restes seiner Forderung von fünfzig Mark feinen Silbers gerieth er mit seinem Vetter Otto in Uneinigkeit. Letzterer, welcher lieber in Güte als nach dem Rechte mit ihm handeln wollte, zahlte sie ihm am 11. Mai 1348 aus. Bald nachdem Herzog Ernst die Regierung angetreten hatte, erhoben sich Irrungen mit dem benachbarten Stifte Hildesheim. Bischof Otto hatte das Amt Freden bei Alfeld an Hermann und Aschwin von Steinberg verpfändet. Mit Bewilligung des nachfolgenden Bischofs Heinrich löseten Ritter Lippold von Vreden, dessen Bruder Basilius und ihre Söhne Hans und Lippold das Amt von den von Steinberg ein und erhielten es mit allem Zubehör nebst den Gerichten von ¡hm für ihre treuen Dienste am 6. Mai 1344 zu Lehn. Zugleich gestattete er ihnen, ein Schloss zu bauen, jedoch nur unter der Bedingung, dass sie damit ihm, dem Stifte, seinen Nachfolgern und bei einer Sedisvacanz dem Domcapitel zu Dienste sitzen und ihm und dem Stifte keinen Schaden davon zufügen sollten. Das Schloss, welches Lippold und Basilius in Folge dessen erbaueten, wurde Neu-Freden genannt. Sie Hessen sich mit demselben und mit dem Hofe zu Engelade bei Seesen 1344 von den Herzögen Magnus und Ernst belehnen. Seit der Theilung der herzoglichen Lande trugen sie das Schloss und den Hof von dem Herzoge Ernst zu Lehn, der ihnen auch wahr scheinlich die Hälfte des Schlosses Gandersheim verpfändete. Der Bischof, den es verdross, dass das in seinem Amte mit seiner Bewilligung erbauete Schloss Neu-Freden herzogliches Lehn geworden war, suchte das Näherrecht daran zu erwerben oder den Vertrag vom 6. Mai 1344 rückgängig zu inachen, welches letztere um so eher gelingen konnte, weil, wie es scheint, das Domcapitel seine Zustimmung, wenn auch zur Erbauung des Schlosses, so doch nicht zu den anderen Bestimmungen des Vertrages ertheilt hatte. Am 17. August 1347 erreichte der Bischof seine Absicht. Es wurde ein neuer Vertrag mit den von Vreden über das Amt, welches sie auf jede Weise sich zu sichern wünschten, geschlossen. Mit Bewilligung des Domcapitels verpfändete der Bischof ihnen auf ihre Lebenszeit für 600 Mark löthigen Silbers das Dorf zu Grossen - Freden, das Amt daselbst mit dem Zehnten, mit Höfen, Leuten und mit dem Gute, ferner das Dorf Oldenrode, das Amt daselbst mit Höfen, Leuten, Gut und mit allen Gerichten, mit dem Patronatrechte zu Grossen-Freden, mit der Wiese vor Alfeld und mit den Kothstellen im alten Dorfe vor Alfeld. Ebenfalls mit Bewilligung seines Domcapitels gestattete er ihnen und ihren Nachkommen, das erbauete Schloss zu behalten, und versprach, sie dabei zu vertheidigen, sie vor Schaden zu bewahren und denjenigen Schaden zu ersetzen, welcher dein Schlosse von des Stiftes ledigen oder nicht verpfändeten noch verlehnten Schlössern zugefügt würde. Er behielt jedoch sich, seinen Nachfolgern und dem Domcapitel bei einer Sedisvacanz das Oefthungsrecht in allen Nöthen gegen jeden vor, indem er sich verpflichtete, zwei Wochen bevor er vom Schlosse Krieg führen würde, ihnen Anzeige davon zu machen. Der alsdann auf das Schloss zu sendende bischöfliche Amtmann sollte ihnen gegen Schaden und Unfug Sicherheit leisten, Thurmleute, Wächter und Pförtner beköstigen und ihnen für eins ihrer Döriir und für ihr Pflugwerk vor dem Schlosse l'riedegut in der Feinde Lande, wo sie es finden könnten, gewähren. Dagegen gelobten sie, den Bischof, das Domcapitel und deren Leute von dem Schlosse vor Schaden zu bewahren und denjenigen Schaden, welcher von dem Schlosse an des Stiftes ledigen Schlössern und Gütern geschähe, zu ersetzen. Der Hauptpunkt des Vertrages bestand darin, dass sie sich verpflichteten, falls sie aus Noth das Schloss verkaufen
XLI
müssten, es ihm, seinen Nachfolgern und dem Domcapitel vor allen anderen anzubieten, es ihnen fur den Preis, den ein anderer böte, zu lassen, auch falls der Bischof oder das Domcapitel dann innerhalb des nächsten Vierteljahres den Ankauf nicht vollführten, das Schloss keinem Fürsten, keinem Herrn und keiner Stadt käuflich zu überlassen und den Käufer in dieselben Verpflichtungen gegen Bischof und Stift treten zu lassen. Durch diesen Vertrag sollte das Schloss, über welches der Herzog Lehnsherr war, dem Bischöfe selbst in einem Kriege gegen denselben dienstbar und der Ankauf des Schlosses dem eigenen Lehnsherrn unmöglich gemacht werden. Es ist nicht unwahrscheinlich, dass deshalb Herzog Ernst mit seinem Bruder, dem Herzoge Magnus, über ein gegen das Stift Hildesheim zu schliessendes Bündniss im April des Jahres 1349 in Unterhandlung trat. Von nun an suchte er in den zum Herzog- thume Lüneburg gehörenden, dem Stifte benachbarten Schlössern sich festzusetzen und deren Besitzer in seinen Dienst zu ziehen. Es gelang ihm mit den Schlössern Eldagsen und Calenberg. Die Grafen Ludolf und Heinrich von Haller mund gelobten am 19. November 1349, ihm mit ihrem Theile des Schlosses der Stadt Eldagsen zehn Jahre lang gegen jeden, gegen den sie ihm nicht innerhalb vier Wochen nach der Anzeige zum Rechte verhülfen, zu Dienste zu sitzen und Hülfe zu leisten. Hiervon nahmen sie die Herzöge zu Lüneburg, deren und ihre eigenen erbgesessenen Mannen aus, gestatteten ihm aber, sich gegen diese Mannen von der Stadt aus zu wehren, falls es ihren Bemühungen nicht gelingen würde zu bewirken, dass dieselben sich am Rechte genügen Hessen. Keller, Küche und Gemächer im Schlosse versprachen sie dem Herzoge und den Seinen einzuräumen, ihni das Schloss in allen Nöthen zu öffnen und mit jedem anderen Schlosse, welches sie mit dem aus dem Verkaufe oder aus der Verpfändung des Schlosses Eldagsen gelöseten Gelde erwerben würden, ihm in derselben Weise zu dienen. Zehn Tage nach diesem Vertrage verpflichteten sie sich, seine Mannen zu werden. Wenn es zweifelhaft bleibt, ob Herzog Ernst seinen Bruder Magnus zum Abschlüsse eines Bündnisses gegen das Stift bewog, so arbeitete er bei seinem Vetter, dem Herzoge Ernst dem älteren aus der grubenhagenschen Linie, mit gutem Erfolge auf ein solches hin. Am 11. Juli des Jahres 1350 begaben sich die von Salder, von Anfang an Feinde des Bischofs Heinrich von Hildesheim, mit ihrem Schlosse Calenberg und mit ihren anderen Schlössern auf die Dauer von ebenfalls zehn Jahren in den Dienst beider Herzöge und der Söhne derselben, Albrecht und Otto, gegen den Bischof Heinrich und, wenn er stürbe oder seine Macht über das Stift Hildes heim verlöre, gegen jeden folgenden Bischof mit Ausnahme des Gegenbischofes Erich von Schauenburg, dessen Partei sie ergriffen hatten. Falls dieser in den Besitz des Bisthums gelangte, wollten sie seines Rechtes vier Wochen lang mächtig sein und, wenn sie den Herzögen während dieser Zeit nicht gegen ihn zum Rechte verhülfen, ihnen gegen ihn wie gegen Bischof Heinrich beistehen. Auch gegen jeden anderen versprachen sie ihnen Hülfe, falls es ihnen nicht gelänge, innerhalb vier Wochen ihnen Recht zu verschaffen. Die gegenseitige Hülfe sollte in folgender Weise geleistet werden. Sobald sie von den Herzögen oder von den von Salder gefordert würde, sollten erstere dreissig, letztere zwanzig Gewaffnete in das Schloss Calenberg legen, während des Krieges jeder die Seinen und beide Theile gemeinsam Wächter, Pförtner und Thurmleute auf dem Schlosse beköstigen. Jeder Theil sollte von der Brandschatzung die Hälfte zu Calenberg aufnehmen. Beute und Gefangene sollten nach Anzahl reisiger Leute getheilt werden. Nähme aber einer der Herzöge persönlich am Kampfe Theil, so sollte er zwar nicht den Bischof, falls derselbe gefangen würde, noch den besten der Gefangenen, wohl aber den zunächst folgenden besten vorab bekommen. Als Friedegut wurde den von Salder Moritzberg, Himmelsthür, Giesen, Wennerde, Giften, Beelte, Escherde, Sorsum und Emmerke verschrieben. Die Herzöge verpflichteten sich, das Schloss Calenberg und die anderen Schlösser der von Salder, falls dieselben belagert würden, mit aller Macht zu entsetzen, den nicht an der Fehde betheiligten Herren und Freunden der von Salder den Schaden zu vergüten, der ihnen von dem Schlosse Calenberg zugefügt würde, den Amtmann, den sie auf das Schloss senden würden, ihnen Burghude leisten und sie durch ihn vor Unfug bewahren zu lassen, falls solcher aber dennoch geschähe, ihnen Vergütung zu leisten. Die von Salder dagegen verpflichteten sich, ohne der Herzöge Bewilligung keine Sühne oder Frieden zu schliessen und sogar das ihren Feinden verliehene herzogliche Geleit zu achten. Durch diesen Vertrag verbanden sich die von Salder gegen jeden mit ausdrückb'cher Ausnahme der Herzöge zu Lüneburg, von denen sie das Schloss Calenberg zu Lehn besassen. Das feindliche Verhältniss gegen das Stift Hildesheim hinderte den Herzog Ernst nicht, am 16. October desselben Jahres die ihm von dem Ritter Aschwin Schenke resignirte und vergütete Vogtei über Höfe zu Barfelde dem Domcapitel zu Hildesheim zum Behuf des Spital-
Sudeodorf, Urkundenbuch IL r
XLII
Urkundenbuch Braunschweig und Lüneburg, ed. Sudendorf, 1859 (Google data) 670, in: Monasterium.net, URL <https://www.monasterium.net/mom/BraunschweigLueneburg/6b7a2087-df65-40ad-9f39-27aad0fce294/charter>, accessed 2025-04-08+02:00
The Charter already exists in the choosen Collection
Please wait copying Charter, dialog will close at success