Urkundenbuch zur Geschichte der Herzöge von Braunschweig und Lüneburg und ihrer Lande bis zum Jahre 1341, Nr. 682, S. 530
Urkundenbuch zur Geschichte der Herzöge von Braunschweig und Lüneburg und ihrer Lande bis zum Jahre 1341, Nr. 682, S. 530
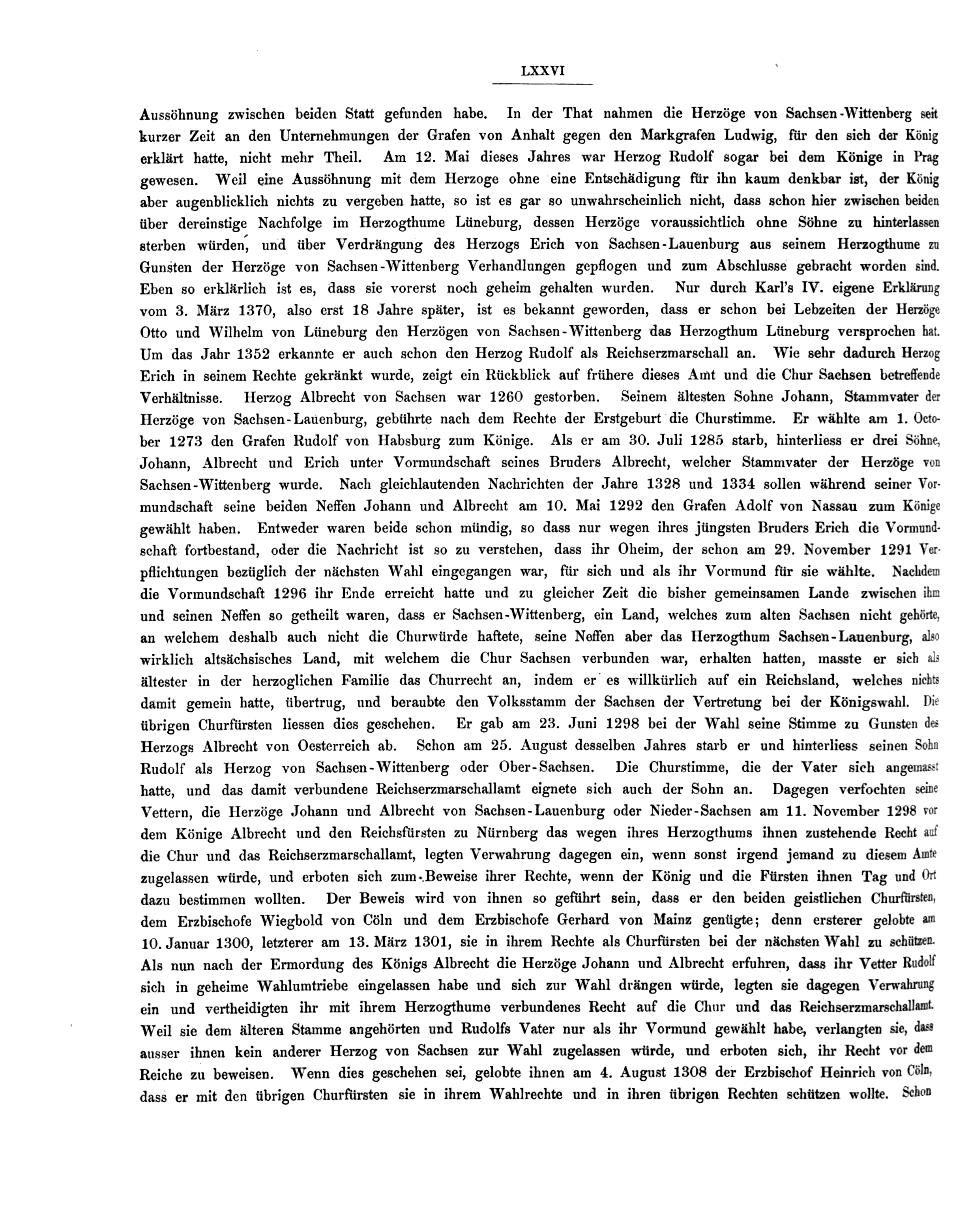
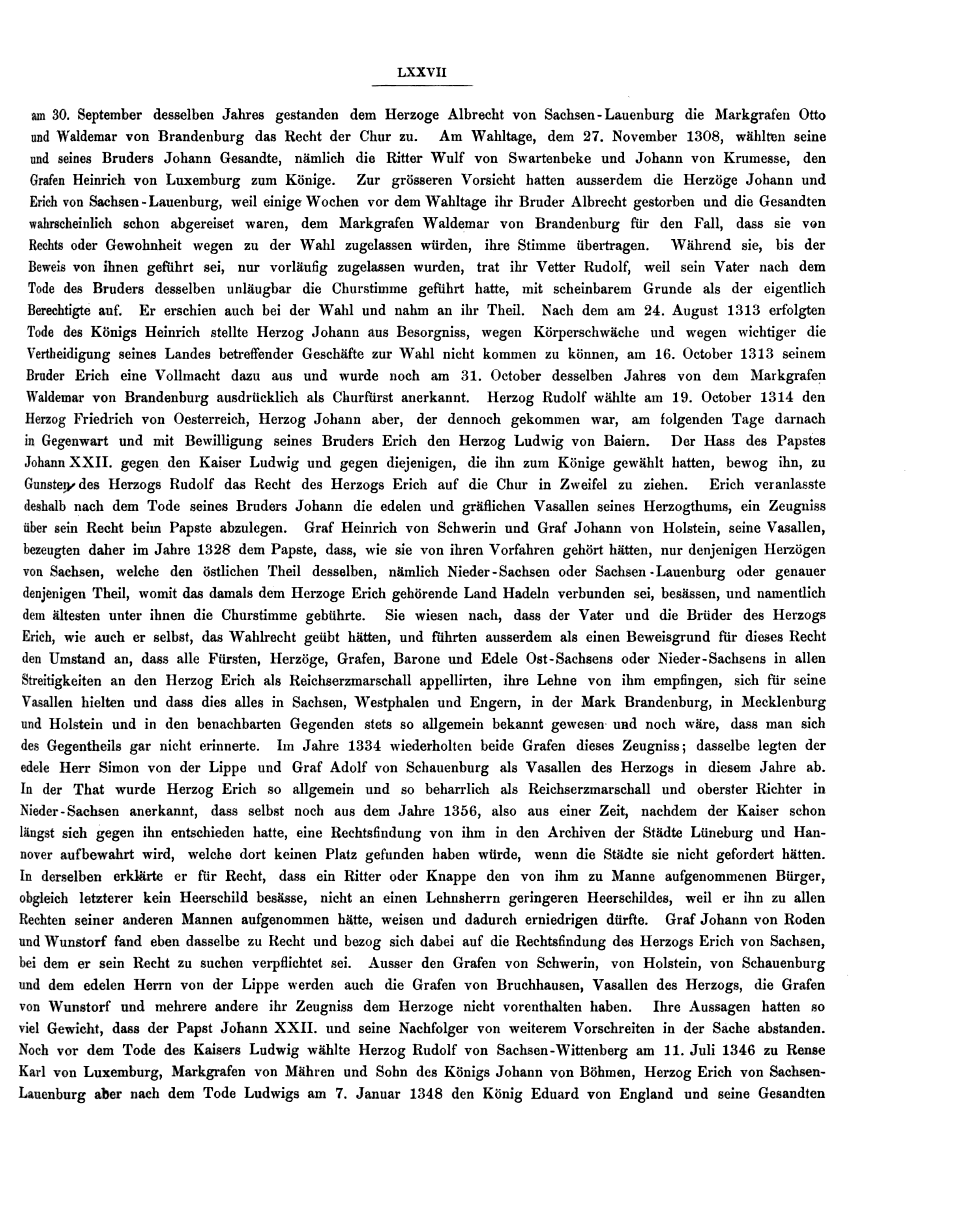
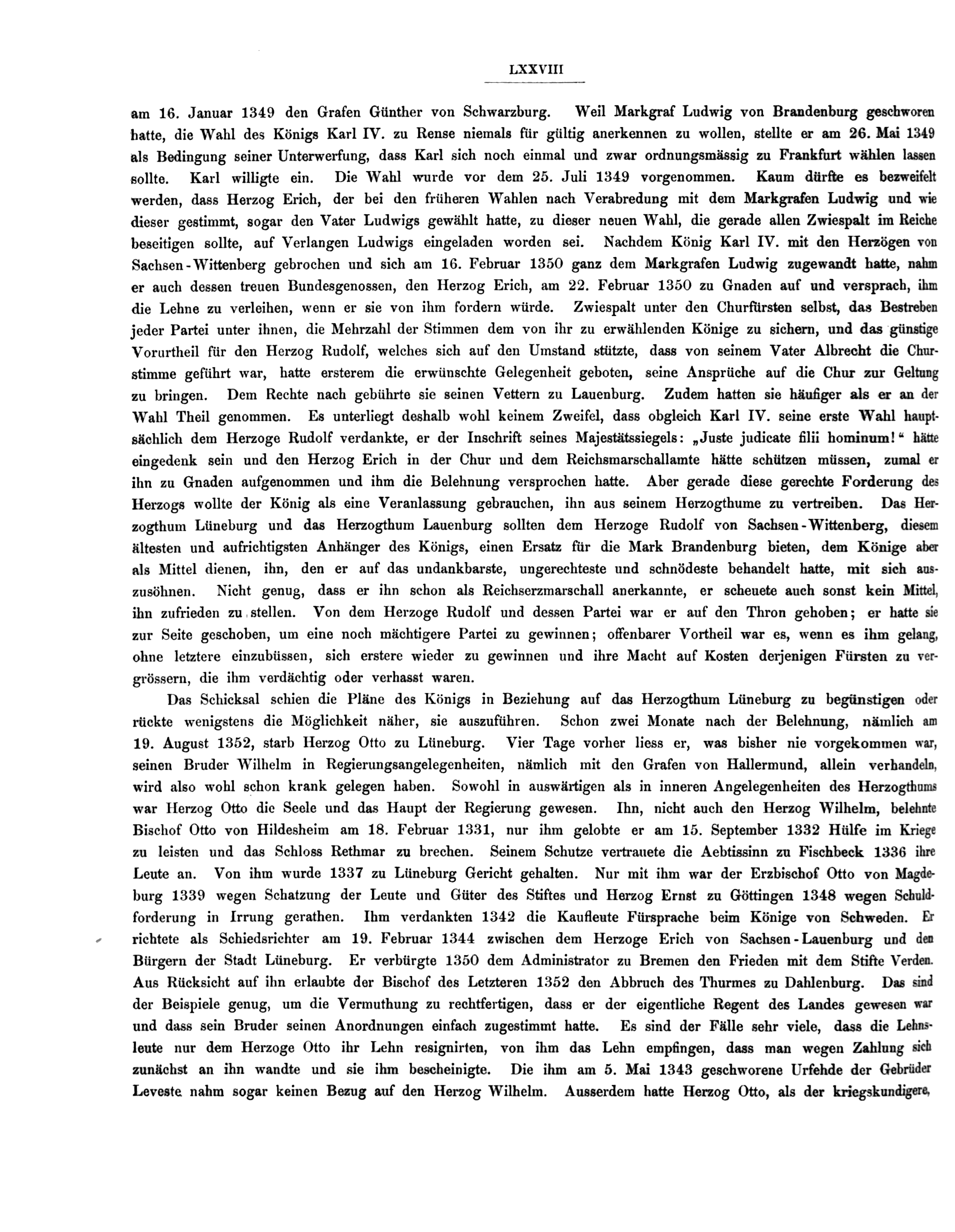
Urkundenbuch zur Geschichte der Herzöge von Braunschweig und Lüneburg und ihrer Lande bis zum Jahre 1341, Nr. 682, S. 530
LXXVII
am 30. September desselben Jahres gestanden dem Herzoge Albrecht von Sachsen - Lauenburg die Markgrafen Otto ond Waldemar von Brandenburg das Recht der Chur zu. Am Wahltage, dem 27. November 1308, wählten seine und seines Bruders Johann Gesandte, nämlich die Ritter Wulf von Swartenbeke und Johann von Krumesse, den Grafen Heinrich von Luxemburg zum Könige. Zur grösseren Vorsicht hatten ausserdem die Herzöge Johann und Erich von Sachsen - Lauenburg, weil einige Wochen vor dem Wahltage ihr Bruder Albrecht gestorben und die Gesandten wahrscheinlich schon abgereiset waren, dem Markgrafen Waldemar von Brandenburg für den Fall, dass sie von Rechts oder Gewohnheit wegen zu der Wahl zugelassen würden, ihre Stimme übertragen. Während sie, bis der Beweis von ihnen geführt sei, nur vorläufig zugelassen wurden, trat ihr Vetter Rudolf, weil sein Vater nach dem Tode des Bruders desselben unläugbar die Churstimme geführt hatte, mit scheinbarem Grunde als der eigentlich Berechtigte auf. Er erschien auch bei der Wahl und nahm an ihr Theil. Nach dem am 24. August 1313 erfolgten Tode des Königs Heinrich stellte Herzog Johann aus Besorgniss, wegen Körperschwäche und wegen wichtiger die Vertheidigung seines Landes betreffender Geschäfte zur Wahl nicht kommen zu können, am 16. October 1313 seinem Bruder Erich eine Vollmacht dazu aus und wurde noch am 31. October desselben Jahres von dem Markgrafen Waldemar von Brandenburg ausdrücklich als Churfürst anerkannt. Herzog Rudolf wählte am 19. October 1314 den Herzog Friedrich von Oesterreich, Herzog Johann aber, der dennoch gekommen war, am folgenden Tage darnach in Gegenwart und mit Bewilligung seines Bruders Erich den Herzog Ludwig von Baiern. Der Hass des Papstes Johann XXII. gegen den Kaiser Ludwig und gegen diejenigen, die ihn zum Könige gewählt hatten, bewog ihn, zu Gunsten/des Herzogs Rudolf das Recht des Herzogs Erich auf die Chur in Zweifel zu ziehen. Erich veranlasste deshalb nach dem Tode seines Bruders Johann die edelen und gräflichen Vasallen seines Herzogthums, ein Zeugniss über sein Recht beim Papste abzulegen. Graf Heinrich von Schwerin und Graf Johann von Holstein, seine Vasallen, bezeugten daher im Jahre 1328 dem Papste, dass, wie sie von ihren Vorfahren gehört hätten, nur denjenigen Herzögen von Sachsen, welche den östlichen Theil desselben, nämlich Nieder-Sachsen oder Sachsen-Lauenburg oder genauer denjenigen Theil, womit das damals dem Herzoge Erich gehörende Land Hadeln verbunden sei, besässen, und namentlich dem ältesten unter ihnen die Churstimme gebührte. Sie wiesen nach, dass der Vater und die Brüder des Herzogs Erich, wie auch er selbst, das Wahlrecht geübt hätten, und führten ausserdem als einen Beweisgrund für dieses Recht den Umstand an, dass alle Fürsten, Herzöge, Grafen, Barone und Edele Ost-Sachsens oder Nieder-Sachsens in allen Streitigkeiten an den Herzog Erich als Reicheerzmarschall appellirten, ihre Lehne von ihm empfingen, sich für seine Vasallen hielten und dass dies alles in Sachsen, Westphalen und Engern, in der Mark Brandenburg, in Mecklenburg und Holstein und in den benachbarten Gegenden stets so allgemein bekannt gewesen und noch wäre, dass man sich des Gegentheils gar nicht erinnerte. Im Jahre 1334 wiederholten beide Grafen dieses Zeugniss; dasselbe legten der edele Herr Simon von der Lippe und Graf Adolf von Schauenburg als Vasallen des Herzogs in diesem Jahre ab. In der That wurde Herzog Erich so allgemein und so beharrlich als Reichserzmarschall und oberster Richter in Nieder - Sachsen anerkannt, dass selbst noch aus dem Jahre 1356, also aus einer Zeit, nachdem der Kaiser schon längst sich gegen ihn entschieden hatte, eine Rechtsfindung von ihm in den Archiven der Städte Lüneburg und Han nover aufbewahrt wird, welche dort keinen Platz gefunden haben würde, wenn die Städte sie nicht gefordert hatten. In derselben erklärte er für Recht, dass ein Ritter oder Knappe den von ihm zu Manne aufgenommenen Bürger, obgleich letzterer kein Heerschild besässe, nicht an einen Lehnsherrn geringeren Heerschiidee, weil er ihn zu allen Rechten seiner anderen Mannen aufgenommen hätte, weisen und dadurch erniedrigen dürfte. Graf Johann von Roden und Wunstorf fand eben dasselbe zu Recht und bezog sich dabei auf die Rechtsfindung des Herzogs Erich von Sachsen, bei dem er sein Recht zu suchen verpflichtet sei. Ausser den Grafen von Schwerin, von Holstein, von Schauenburg und dem edelen Herrn von der Lippe werden auch die Grafen von Bruchhausen, Vasallen des Herzogs, die Grafen von Wunstorf und mehrere andere ihr Zeugniss dem Herzoge nicht vorenthalten haben. Ihre Aussagen hatten so viel Gewicht, dass der Papst Johann XXII. und seine Nachfolger von weiterem Vorschreiten in der Sache abstanden. Noch vor dem Tode des Kaisers Ludwig wählte Herzog Rudolf von Sachsen-Wittenberg am 11. Juli 1346 zu Rense Karl von Luxemburg, Markgrafen von Mähren und Sohn des Königs Johann von Böhmen, Herzog Erich von Sachsen- Lauenburg aber nach dem Tode Ludwigs am 7. Januar 1348 den König Eduard von England und seine Gesandten
LXXVIH
am 16. Januar 1349 den Grafen Günther von Schwarzburg. Weil Markgraf Ludwig von Brandenburg geschworen hatte, die Wahl des Königs Karl IV. zu Rense niemals für gültig anerkennen zu wollen, stellte er am 26. Mai 1349 als Bedingung seiner Unterwerfung, dass Karl sich noch einmal und zwar ordnungsmässig zu Frankfurt wählen lassen sollte. Karl willigte ein. Die Wahl wurde vor dem 25. Juli 1349 vorgenommen. Kaum dürfte es bezweifelt werden, dass Herzog Erich, der bei den früheren Wahlen nach Verabredung mit dem Markgrafen Ludwig und wie dieser gestimmt, sogar den Vater Ludwigs gewählt hatte, zu dieser neuen Wahl, die gerade allen Zwiespalt im Reiche beseitigen eoUte, auf Verlangen Ludwigs eingeladen worden sei. Nachdem König Karl IV. mit den Herzögen von Sachsen-Wittenberg gebrochen und sich am 16. Februar 1350 ganz dem Markgrafen Ludwig zugewandt hatte, nahm er auch dessen treuen Bundesgenossen, den Herzog Erich, am 22. Februar 1350 zu Gnaden auf und versprach, ihm die Lehne zu verleihen, wenn er sie von ihm fordern würde. Zwiespalt unter den Churfürsten selbst, das Bestreben jeder Partei unter ihnen, die Mehrzahl der Stimmen dem von ihr zu erwählenden Könige zu sichern, und das günstige Vorurtheil für den Herzog Rudolf, welches sich auf den Umstand stützte, dass von seinem Vater Albrecht die Chur- stimme geführt war, hatte ersterem die erwünschte Gelegenheit geboten, seine Ansprüche auf die Chur zur Geltung zu bringen. Dem Rechte nach gebührte sie seinen Vettern zu Lauenburg. Zudem hatten sie häufiger als er an der Wahl Theil genommen. Es unterliegt deshalb wohl keinem Zweifel, dass obgleich Karl IV. seine erste Wahl haupt sächlich dem Herzoge Rudolf verdankte, er der Inschrift seines Majestätssiegels: „Juste judicate filii hominum!" hätte eingedenk sein und den Herzog Erich in der Chur und dem Reichsmarschallamte hätte schützen müssen, zumal er ihn zu Gnaden aufgenommen und ihm die Belehnung versprochen hatte. Aber gerade diese gerechte Forderung des Herzogs wollte der König als eine Veranlassung gebrauchen, ihn aus seinem Herzogthume zu vertreiben. Das Her- zogthum Lüneburg und das Herzogthum Lauenburg sollten dem Herzoge Rudolf von Sachsen-Wittenberg, diesem ältesten und aufrichtigsten Anhänger des Königs, einen Ersatz für die Mark Brandenburg bieten, dem Könige aber als Mittel dienen, ihn, den er auf das undankbarste, ungerechteste und schnödeste behandelt hatte, mit sich aus zusöhnen. Nicht genug, dass er ihn schon als Reichserzmarschall anerkannte, er scheuete auch sonst kein Mittel, ihn zufrieden zu stellen. Von dem Herzoge Rudolf und dessen Partei war er auf den Thron gehoben; er hatte sie zur Seite geschoben, um eine noch mächtigere Partei zu gewinnen; offenbarer Vortheil war es, wenn es ihm gelang, ohne letztere einzubüssen, sich erstere wieder zu gewinnen und ihre Macht auf Kosten derjenigen Fürsten zu ver- grössern, die ihm verdächtig oder verhasst waren.
Urkundenbuch Braunschweig und Lüneburg, ed. Sudendorf, 1859 (Google data) 682, in: Monasterium.net, URL <https://www.monasterium.net/mom/BraunschweigLueneburg/81ee46eb-c5fa-44f5-8b86-a42a09fa8448/charter>, accessed 2025-04-17+02:00
The Charter already exists in the choosen Collection
Please wait copying Charter, dialog will close at success