Urkundenbuch zu der Geschichte des Reichstages zu Augsburg im Jahre 1530, Nr. 148, S. 480
Current repository:
Urkundenbuch zu der Geschichte des Reichstages zu Augsburg im Jahre 1530, Nr. 148, S. 480
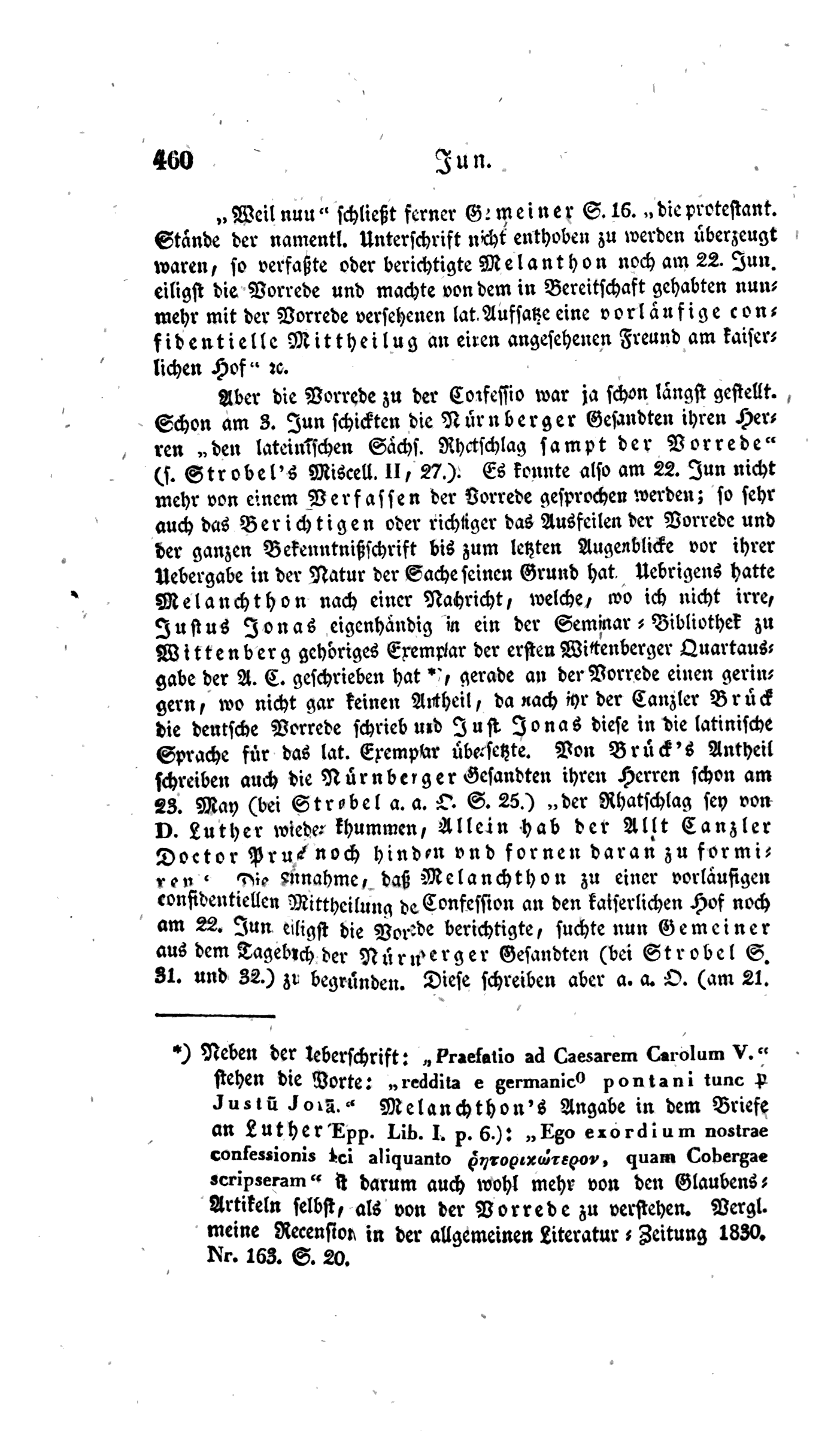
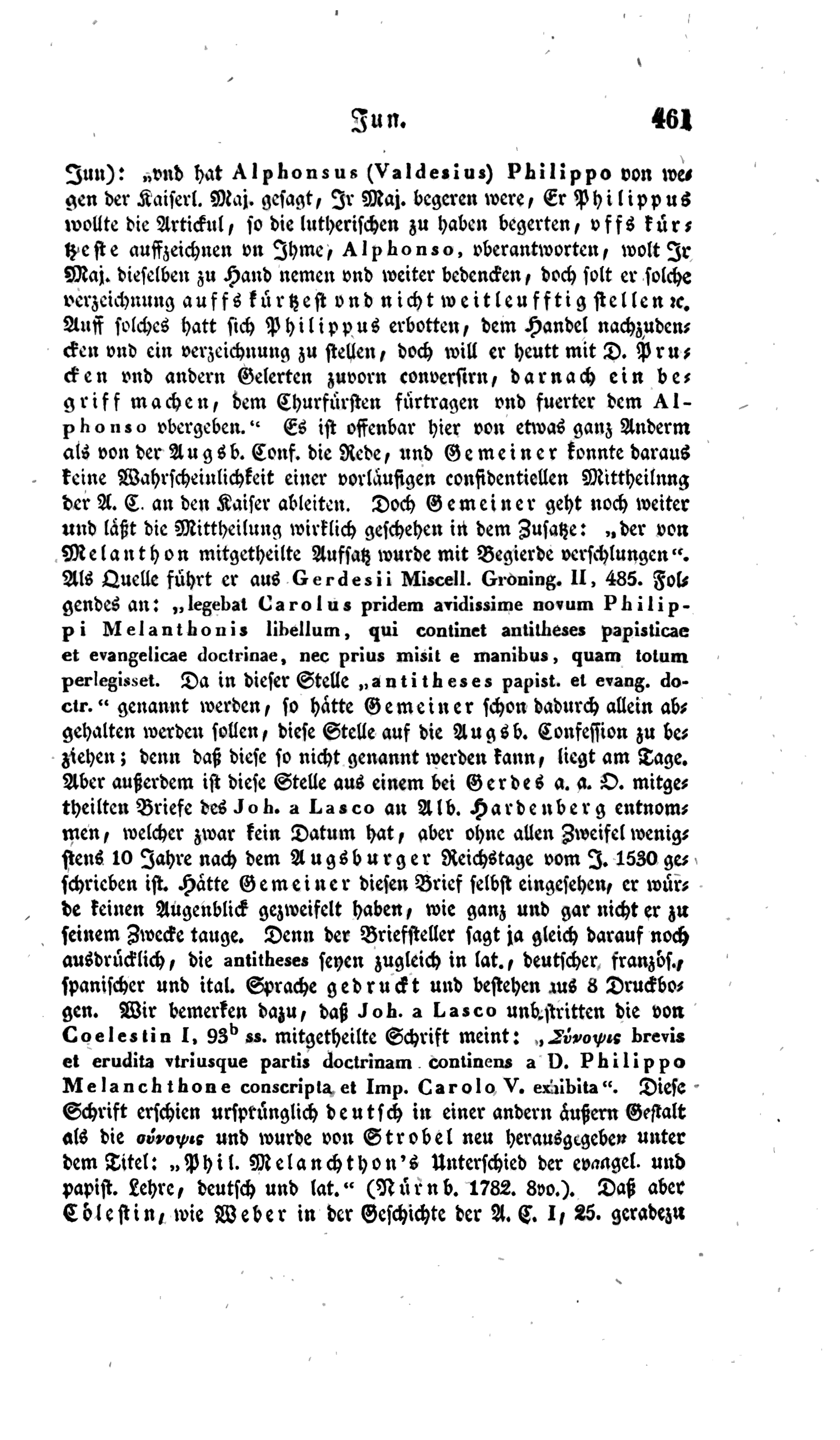
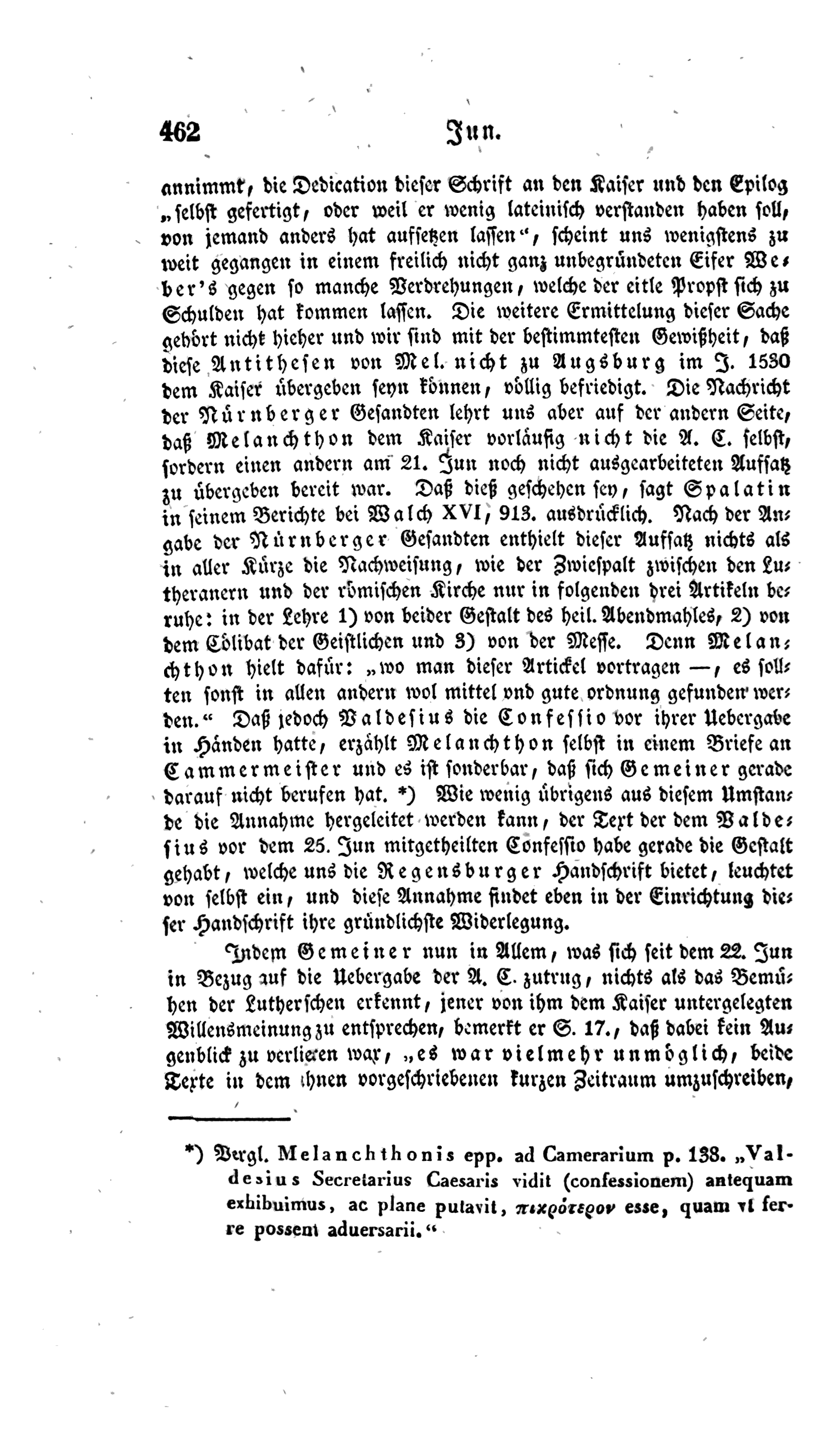
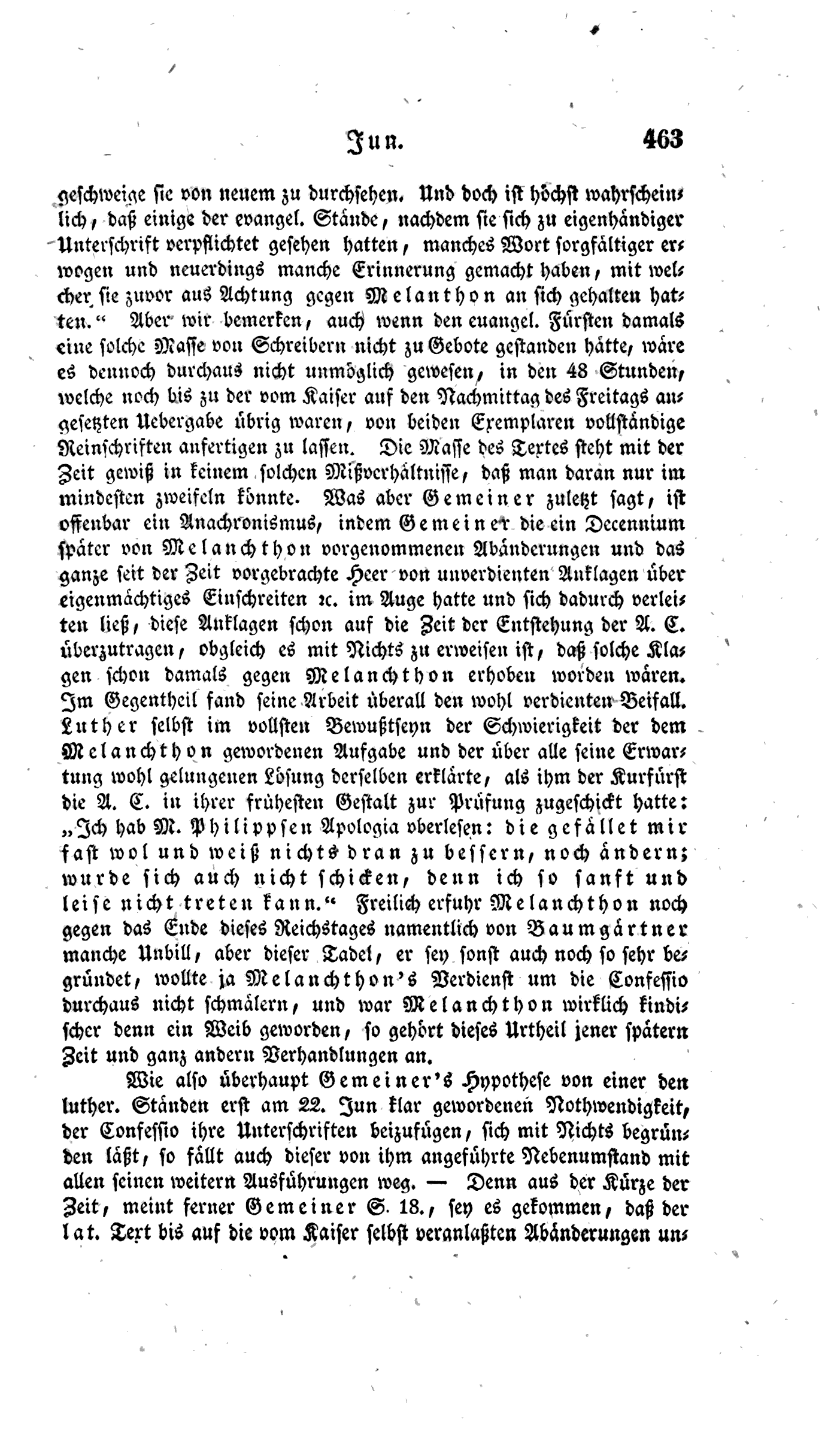
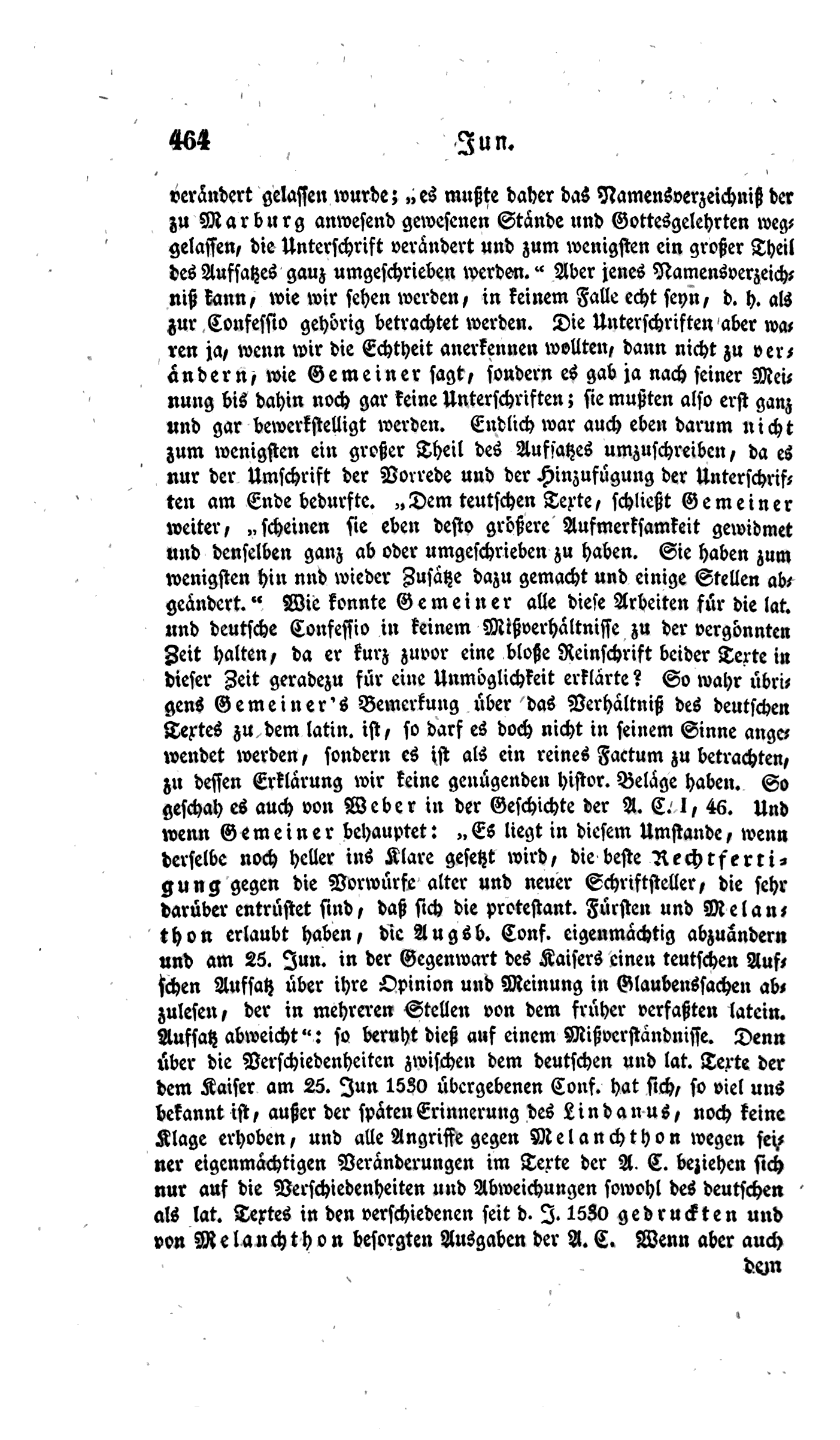
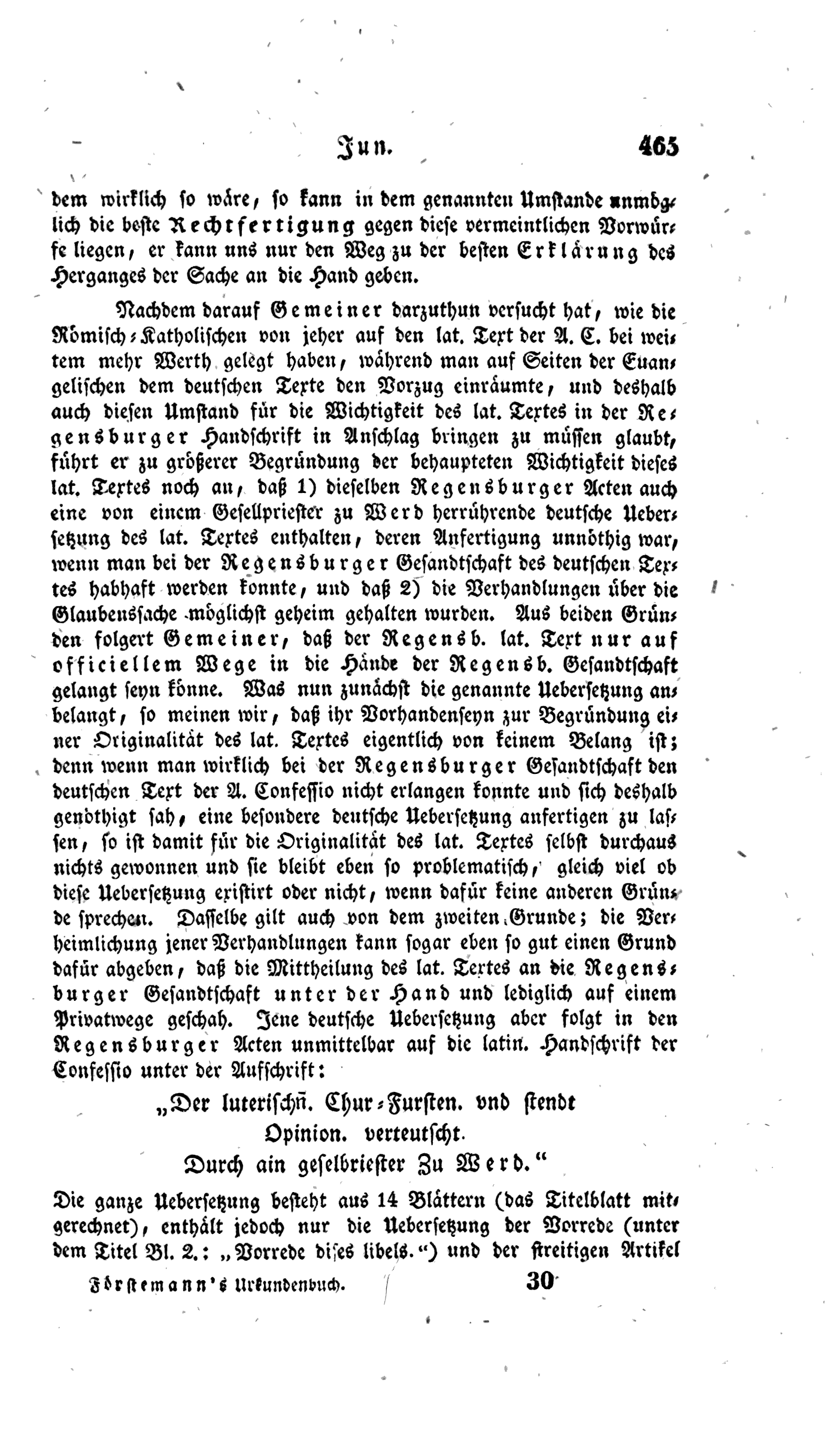
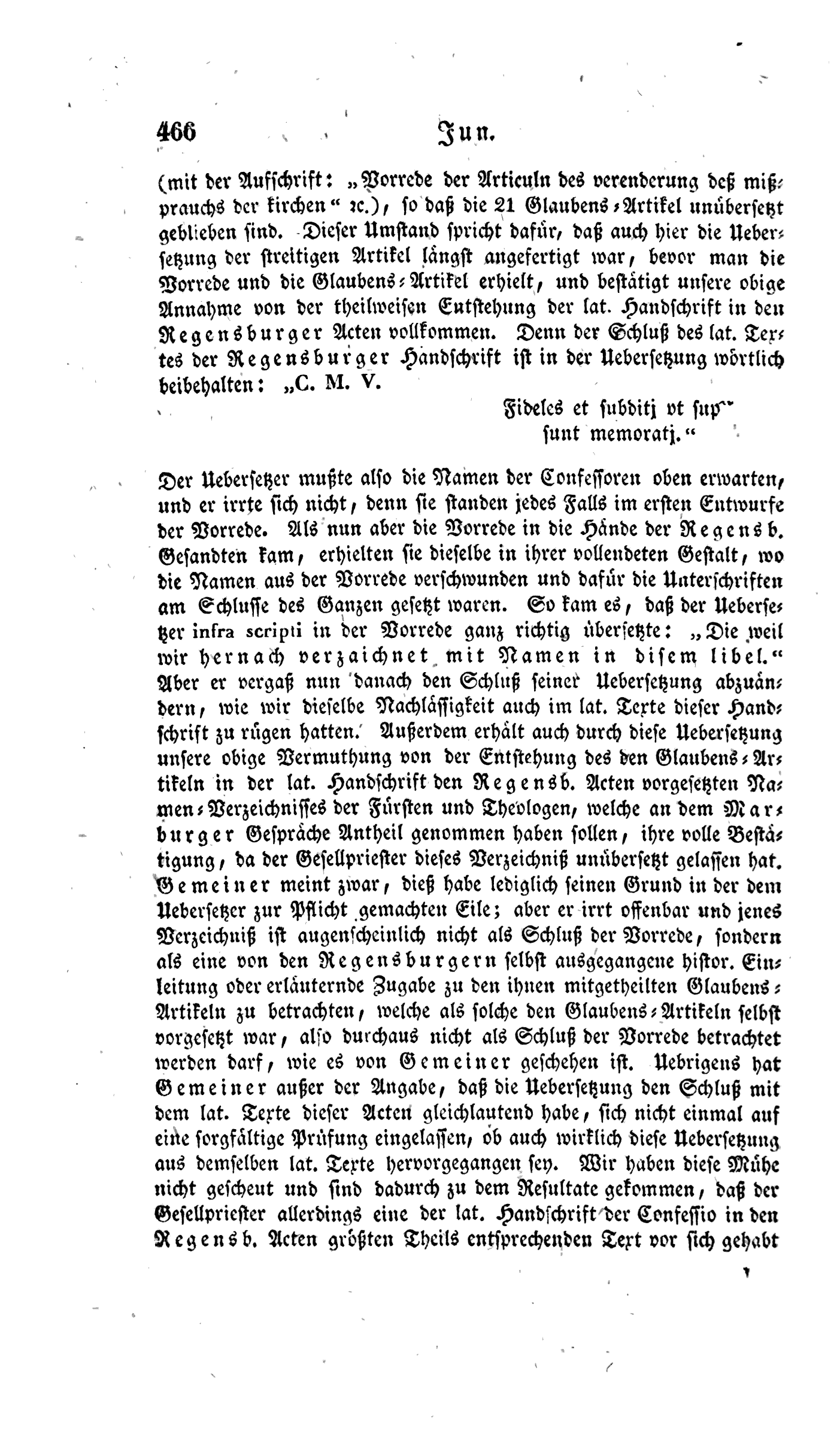
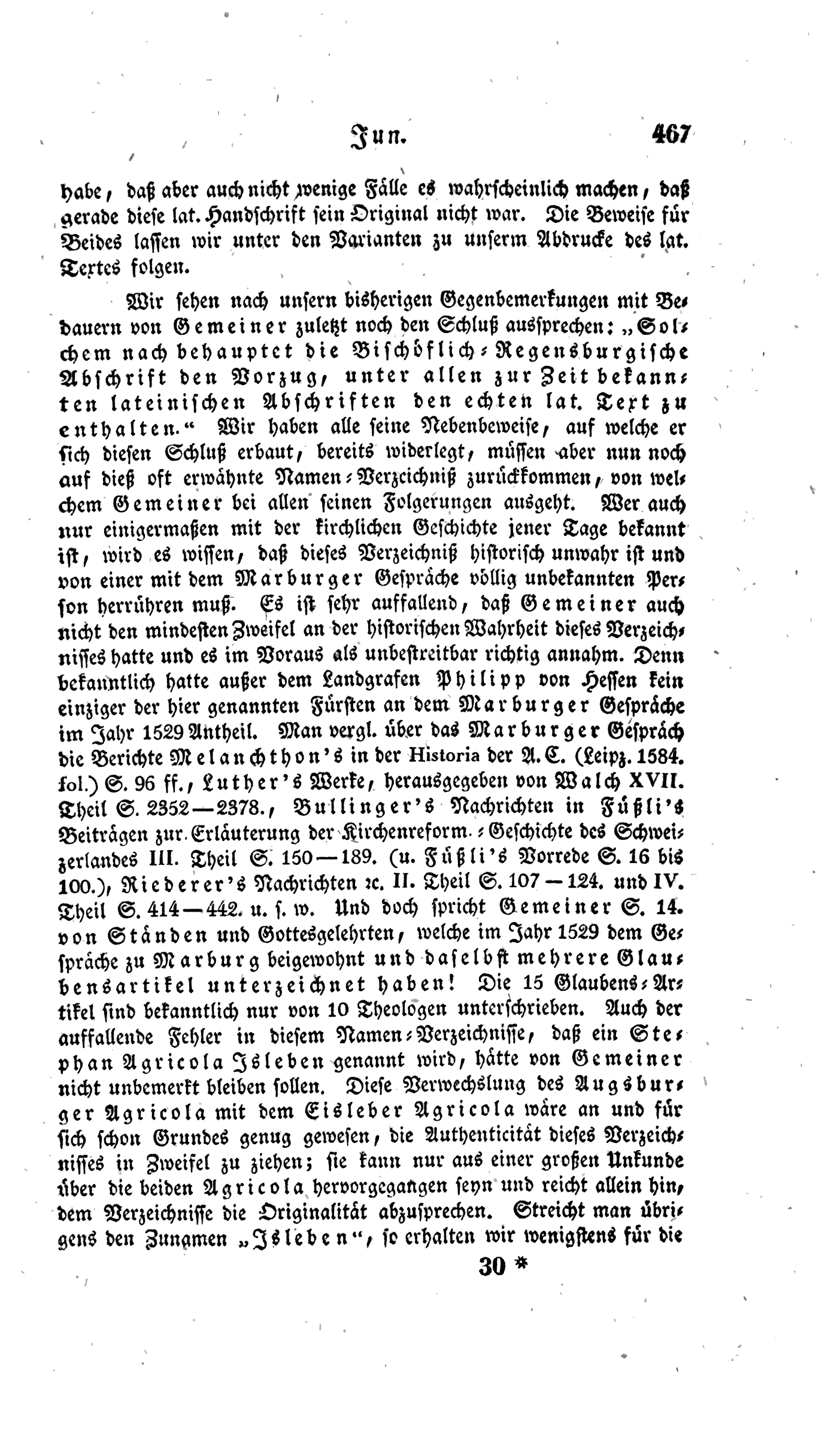
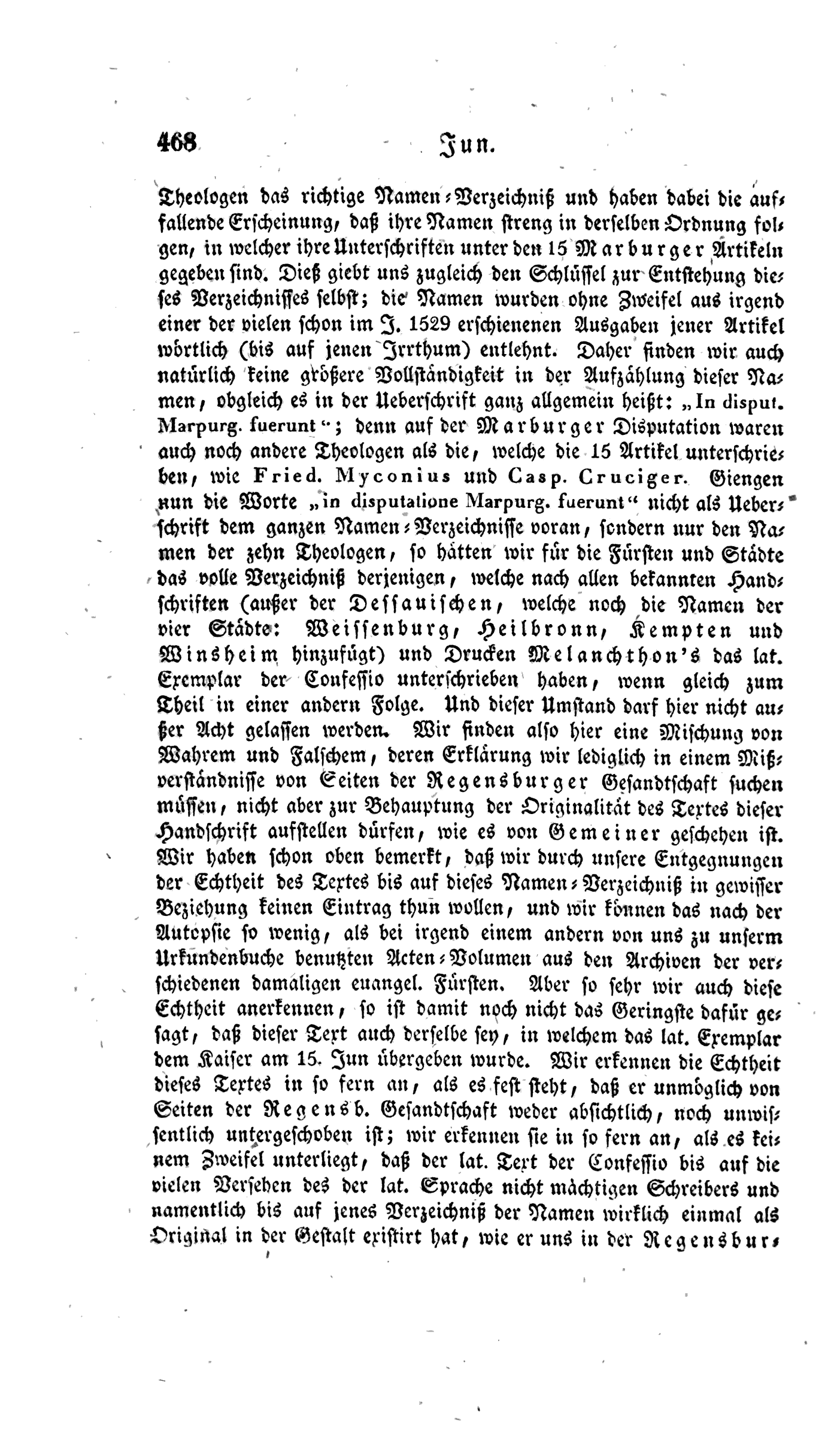
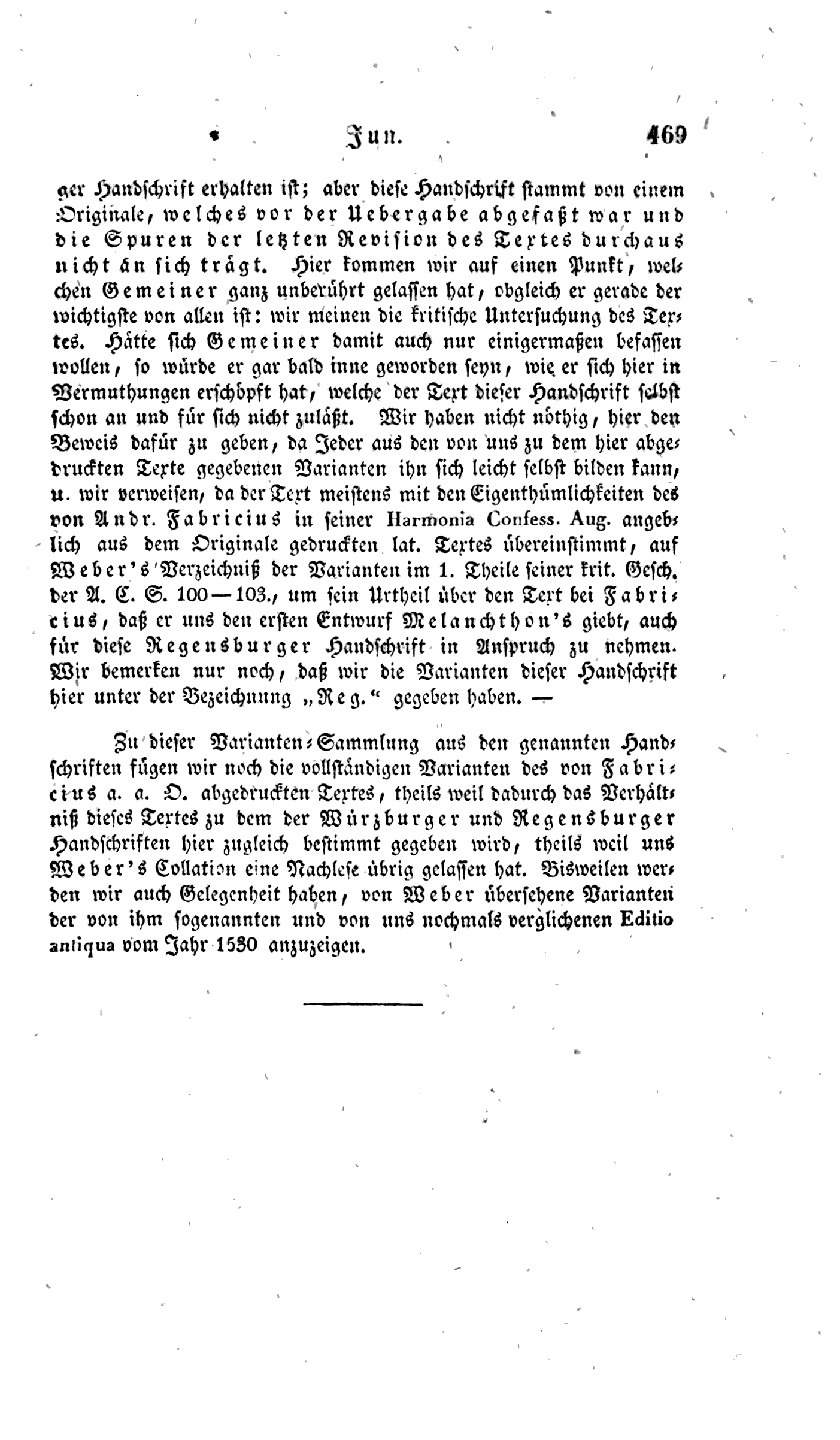
,cr!p,el2m« tz darum auch wohl mehr von den Glaubens- Artikeln selbst, als von der Vorrede zu verstehen. Vcrgl. meine Recensiok in der allgemeinen literatur « Zeitung 1830. dir. 163. S. 20.
Iun. 46l
Jim): „v»d hat ^Ipl>on5ii« (V,!<ie,lu,) pliillpp«, von w«
gen der Kaiser!. Maj. gesagt, Ir Maj. bcgcren wcre, Er Phi lippus »vollte die Artickul, fo die lutherischen zu haben bcgerten, vffs kür» tzcste auffzeichnen vn Ihme, ^lpüon«», vberantworten, wolt Ir Maj. dieselbe» zu Hand nemen vnd weiter bcdcncken, doch solt er solche Verzeichnung auffs lürtzest und nicht weitlcufftig stellen »c. Auff solches hatt sich Phi lippus erbotten, dem Handel nachzudcn- cken vnd ein Verzeichnung zu stellen, doch will er hcutt mit D. Pru- cken vnd andern Gelcrten zuvor» convcrsirn, darnach ein de, griff machen, dem Churfürsten fürtragen vnd fuerter dem ^1- pKon 5« vbergeben." Es ist offenbar hier von etwas ganz Andern» als von der Au g sb. Conf. die Rede, und Gemeiner konnte daraus keine Wahrscheinlichkeit einer vorlausigen confidentiellen Mittheilnng der A. C, an den Kaiser ableiten. Doch Gemeiner geht noch weiter und laßt die Mittheilnng wirklich geschehen in dem Zusätze: „der von Melanthon mitgetheilte Aufsatz wurde mit Begierde verschlungen". Als Quelle führt er aus Kri-6e«ii Kli««!!. Kiouinß. II, 485. Fol«
gcndes an! „leßel»«l <^2rolu« z>ri<5eril «^><l!l«ime nuvun» ?i>ilin. z>> lVIelHnlüoii!» lüiellum, «zui conlinet »nlilue«« P2pi«lic2e et ev«nß«Ii«>e <!n<^!iin»«, n«c ^>r!u« in!«il e m«n!l>u«, ^u»m lolunl ^erlegiüxel. Da in dieser Stelle ,,2>ntitlie«e« N2p!5t. el e,2!,z. 6«. e»r.« genannt werden, so hatte Gemeiner schon dadurch allein ab- gehalten werden sollen, diese Stelle auf die Augsb. Confession zu be ziehen; denn daß diese so nicht genannt werden kann, liegt am Tage. Aber außerdem ist diese Stelle aus einem bei Gcrdes a. a. O. mitge- theilten Briefe des^nl,. » I.2«cu an Alb. Hardenberg entnom- men, welcher zwar kein Datum hat, aber ohne allen Zweifel wenig« stens 10 Jahre nach dem Augsburger Reichstage vom 1.1530 ge- schrieben ist. Hätte Gemeiner diesen Brief selbst eingesehen, er wür de keinen Augenblick gezweifelt haben, wie ganz und gar nicht er zu seinem Zwecke tauge. Denn der Briefsteller sagt ja gleich darauf noch ausdrücklich, die »nliln««« seycn zugleich in lat., deutscher franzds./ spanischer und ital. Sprache gedruckt und bestehen aus 8 Druckbo gen. Wir bemerken dazu, daß ^ol>. 2 ^»«co und.stritten die von <5n«le«tin I, 93b««. mitgetheilte Schrift meint: ,^!!v«v>ll Krevi« et eru<lit2 vtriul^ue n»rti» <Iuclr!n2lN cunlinenH 2 I). ?uil!pz><» I^lellinclittloiie con«crip!a et Iinp. (! 2 r 01o V. e«!l»!t» ". Dies« Schrift erschien ursprünglich deutsch in einer andern äußern Gestalt als die »<,'?<,v<»c und wurde von Strobel neu herausgegeben unter dem Titel: „Phil. Melanchthon's Unterschied der cvangel. und papist. Lehre, deutsch und lat." (Nürnb. 1782. 8vo.). Daß aber Cdlestin/ wie Weber in der Geschichte der A. C. I, 25. geradezu
462 Iun.
annimmt, die Dedication dieser Schrift an den Kaiser und den Epilog „selbst gefertigt, oder weil er wenig lateinisch verstanden haben soll, von jemand anders hat aufsetzen lassen", scheint uns wenigstens zu weit gegangen in einem freilich nicht ganz unbegründeten Eifer W c, ber's gegen so manche Verdrehungen, welche der eitle Propst sich zu Schulden hat kommen lassen. Die weitere Ermittelung dieser Sache gehört nicht hicher und wir sind mit der bestimmtesten Gewißheit, daß diese Antithesen von Mel. nicht zu Augsburg im I. 1550 dem Kaiser übergeben seyn können, völlig befriedigt. Die Nachricht der Nürnberger Gesandten lehrt uns aber auf der andern Seite, daß Melanchthon dem Kaiser vorlaufig nicht die A. C. selbst, fordern einen andern am 21. Hun noch nicht ausgearbeiteten Aufsatz zu übergeben bereit war. Daß dieß geschehen sey, sagt Spalatin in seinem Berichte bei WaIch XVI, 913. ausdrücklich. Nach der An gabe der Nürnberger Gesandten enthielt dieser Aufsatz nichts als in aller Kürze die Nachwcisung, wie der Zwiespalt zwischen den Lu theranern und der römischen Kirche nur in folgenden drei Artikeln be ruhe: in der Lehre 1) von beider Gestalt des heil. Abendmahles, 2) von dem Cdlibat der Geistlichen und 3) von der Messe. Denn Welanl chthon hielt dafür: „wo man dieser Artickel vortragen —, es soll ten sonst in allen andern wol mittel vnd gute ordnung gefunden'wer den." Daß jedoch Valdesius die Confefsiovor ihrer Uebcrgabe in Händen hatte, erzählt Melanchthon selbst in einem Briefe an Cammer meister und es ist fonderbar, daß sich Gemeiner gerade darauf nicht berufen hat. ') Wie wenig übrigens aus diesem Umstän de die Annahme hergeleitet werden kann, der Tert der dem Valde sius vor dem 25. Iun mitgctheilten Confessio habe gerade die Gestalt gehabt, welche uns die Regensburger Handschrift bietet, leuchtet von selbst ein, und diese Annahme findet eben in der Einrichtung die ser Handschrift ihre gründlichste Widerlegung.
I),dcm Gemeiner nun in Allem, was sich seit dem 22. Iun in Bezug auf die Uebcrgabe der A. C- zutrug, nichts als das Bemü hen der Lutherschen erkennt, jener von ihm dem Kaiser untergelegten Willensmeinung zu entsprechen, bemerkt er S. 17., daß dabei kein Au genblick zu verlieren wax, „es war vielmehr unmöglich, beide Terte in dem chnen vorgeschriebenen kurzen Zeitraum umzuschreiben,
') Vlrgl. Hle!,ncl>tKon!5 epp. 26 t!l>iner2r!uln p. 133. >,V,l> äe»iu5 8ecie!2>!u« 02e«2i!« viclit (con5e«ioi!em) »n!e<^>i2Ni «lübuimu«, 2c plane pul^vil, ?r»ie?<>«5«>»> e«e, <zu»n> vl ler> re z>o«em 2<luer«rii."
Iun. 463
geschweige sie von neuem zu durchsehen. Und doch ist höchst wahrschein» lich, daß einige der cvangel. Staude, nachdem sie sich zu eigenhändiger Unterschrift verpflichtet gesehen hatten, manches Wort sorgfaltiger er- wogen und neuerdings manche Erinnerung gemacht haben, mit wel cher sie zuvor aus Achtung gegen Mclanthon an sich gehalten hat ten." Aber wir bemerken, auch wenn den cuangel. Fürsten damals ciue solche Masse von Schreibern nicht zu Gebote gestanden hatte, wäre es dennoch durchaus nicht unmöglich gewesen^ in den 48 Stunden, welche noch bis zu der vom Kaiser auf den Nachmittag des Freitags an gesetzten Ucbergabe übrig waren, von beiden Exemplaren vollständige Neinschriften anfertigen zu lassen. Die Masse des Textes steht mit der Zeit gewiß in keinem solchen Mißverhältnisse, daß man daran nur im mindesten zweifeln könnte- Was aber Gemeiner zuletzt sagt, ist offenbar ei» Anachronismus, indem Gemein ei,' die ein Decennium später von Melanchtho» vorgenommenen Abänderungen und das ganze seit der Zeit vorgebrachte Heer von unverdienten Anklagen über eigenmächtiges Einschreiten ,c. im Auge hatte und sich dadurch verlei ten ließ, diese Anklagen schon auf die Zeit der Entstehung der A. C. überzutragen, obgleich es mit Nichts zu erweisen ist, daß solche Kla gen schon damals gegen Melanchtho« erhoben worden wären. Im Gegentheil fand seine Arbeit überall den wohl verdienten Beifall. Luther selbst im vollsten Bewußtseyn der Schwierigkeit der dem Mclanchthon gewordenen Aufgabe und der über alle seine Erwar tung wohl gelungenen Lösung derselben erklärte, als ihm der Kurfürst die A. C. i» ihrer frühesten Gestalt zur Prüfung zugeschickt hatte: »Ich Hab M. Philipps«» Apologia vberlesen: die gefället mir fast wol und weiß nichts- dran zu bessern, noch ändern; wurde sich auch nicht schicken, denn ich so sanft und leise nicht treten kann." Freilich erfuhr Melanchtho« noch gegen das Ende dieses Reichstages namentlich von Baumgärtner manche Unbill, aber dieser Tadel, er seu sonst auch noch so sehr be gründet, wollte ja Melanchthon's Verdienst um die Confessio durchaus nicht schmälern, und war Melanchtho» wirklich kindi scher denn ein Weib geworden, so gehört dieses Urtheil jener später« Zeit und ganz andern Verhandlungen an.
Wie also überhaupt Gemeiner's Hypothese von einer den luther. Ständen erst am 22. Iun klar gewordenen Notwendigkeit, der Confessio ihre Unterschriften beizufügen, sich mit Nichts begrün den läßt, so fällt auch dieser von ihm angeführte Ncbenumstand mit allen seinen weitern Ausführungen weg. — Denn aus der Kürze der Zeit, meint ferner Gemeiner S 18., sey es gekommen, daß der l a t. Text bis auf die vom Kaiser selbst veranlaßten Abänderungen un
464 Iun.
verändert gelassen wurde; »es mußte daher das Namensverzeichniß der zu Marburg anwesend gewesenen Stände und Gottesgelehrten weg gelassen, die Unterschrift verändert und zum wenigsten ein großer Theil des Aufsatzes gauz umgeschrieben werden." Aber jenes Namensverzeich, nißtann, wie wir sehen werden, in keinem Falle echt seyn, d. h. als zur Coufessio gehörig betrachtet werden. Die Unterschriften aber wa, ren ja/ wenn wir die Echtheit anerkennen wollten, dann nicht zu »er, ändern, wie Gemeiner sagt, sondern es gab ja nach seiner Mei, nung bis dahin noch gar keine Unterschriften; sie mußten also erst ganz und gar bewerkstelligt werden. Endlich war auch eben darum nicht zum wenigsten ein großer Theil des Aufsatzes umzuschreiben, da es nur der Umschrift der Vorrede und der Hinzufügung der Unterschrift ten am Ende bedurfte. „Dem teutschen Texte, schließt Gemeiner weiter, „scheinen sie eben desto größere Aufmerksamkeit gewidmet und denselben ganz ab oder umgeschrieben zu haben. Sie haben zum wenigsten hin nnd wieder Zusätze dazu gemacht und einige Stellen ab, geändert." Wie konnte Gemeiner alle diese Arbeiten für die lat. und deutsche Coufessio in keinem Mißverhältnisse zu der vergönnten Zeit halten, da er kurz zuvor eine bloße Reinschrift beider Texte in dieser Zeit geradezu für eine Unmöglichkeit erklarte? So wahr übri, gens Gemein er's Bemerkung über das Verhältnis; des deutschen Textes zu dem latin. ist, so darf es doch nicht in seinem Sinne angc, wendet werden, sondern es ist als ein reines Factum zu betrachten, zu dessen Erklärung wir keine genügenden histor. Beläge haben. So geschah es auch von Weber in der Geschichte der A. C. I, 46. Und wenn Gemeiner behauptet: „ ES liegt in diesem Umstände, wenn derselbe noch Heller ins Klare gesetzt wird, die beste Rechtferti gung gegen die Vorwürfe alter und neuer Schriftsteller, die sehr darüber entrüstet sind, daß sich die Protestant. Fürsten und Melan, thon erlaubt haben, die Augsb. Conf. eigenmächtig abzuändern und am 25. Iun. in der Gegenwart des Kaisers einen teutschen Auf, schen Aufsatz über ihre Opinion und Meinung in Glaubenssachen ab, zulesen, der in mehreren Stellen von dem früher verfaßten latcin. Aufsatz abweicht": so beruht dieß auf einem Mißverständnisse. Denn über die Verschiedenheiten zwischen dem deutschen und lat. Texte der dem Kaiser am 25. Iun 1530 übergebenen Conf. hat sich, so viel uns bekannt ist, außer der späten Erinnerung des Lindanus, noch keine Klage erhoben, und alle Angriffe gegen Welanchthon wegen sei, ner eigenmächtigen Veränderungen im Texte der A, C. beziehen sich nur auf die Verschiedenheiten und Abweichungen sowohl des deutschen als lat. Textes in den verschiedenen seit d. 1.1530 gedruckten und von Melanchthon besorgten Ausgaben der A. C. Wenn aber auch
dun
Iun. 465
dem wirklich so wäre, so kann in dem genannten Umstände »nmbg/ lich die beste Rechtfertigung gegen diese vermeintlichen Vorwüre fe liegen, er kann uns nur den Weg zu der besten Erklärung des Herganges der Sache an die Hand geben.
Nachdem darauf Gemeiner darzuthun versucht hat, wie die Römisch > Katholischen von jeher auf den lat. Text der A. C. bei wei, tem mehr Wcrth gelegt haben, während man auf Seiten der Euan, gelischen dem deutschen Texte den Vorzug einräumte, und deshalb auch diesen Umstand für die Wichtigkeit des lat. Textes in der Re < gensburger Handschrift in Anschlag bringen zu müssen glaubt, führt er zu größerer Begründung der behaupteten Wichtigkeit dieses lat. Textes noch au, daß 1) dieselben Regensburger Acten auch eine von einem Gesellpriestcc zu Werd herrührende deutsche Ueber« setzung des lat. Textes enthalten, deren Anfertigung unndthig war, wenn man bei der Regensburger Gesandtschaft des deutschen Lex, tes habhaft werden konnte, und daß 2) die Verhandlungen über die Glaubenssache möglichst geheim gehalten wurden. Aus beiden Grün, den folgert Gemeiner, daß der Regensb. lat. Text nur auf officiellem Wege in die Hände der Regensb. Gesandtschaft gelangt seyn könne. Was nun zunächst die genannte Uebersetzung an, belangt, so meinen wir, daß ihr Vorhandenseyn zur Begründung ei, ner Originalität des lat, Textes eigentlich von keinem Belang ist; denn wenn man wirklich bei der Regensburger Gesandtschaft den deutschen Text der A. Confessio nicht erlangen konnte und sich deshalb gendthigt sah, eine besondere deutsche Uebersetzung anfertigen zu las, sen, so ist damit für die Originalität des lat. Textes selbst durchaus nichts gewonnen und sie bleibt eben so problematisch, gleich viel ob diese Uebersetzung existirt oder nicht, wenn dafür keine anderen Grün» de spreche«. Dasselbe gilt auch von dem zweiten,Grunde; die Ver» heimlichung jener Verhandlungen kann sogar eben so gut einen Grund dafür abgeben, daß die Mittheilung des lat. Textes an die Regens, burger Gesandtschaft unter der Hand und lediglich auf einem Privatwege geschah. Jene deutsche Uebersetzung aber folgt in den Regensburger Acten unmittelbar auf die latin. Handschrift der Confessio unter der Aufschrift:
„Der lmerischn. Chur «Fürsten, vnd stendt
Opinion. verteutscht.
Durch am geselbriester Zu Werd."
Die ganze Uebersetzung besteht aus 14 Blättern (das Titelblatt mit, gerechnet), enthalt jedoch nur die Uebersetzung der Vorrede (unter dem Titel VI. 2.: „ Vorrede dises libels.") und der streitigen Artikel
Zirstemann's Urlundenbuch. i 2<l
4«Y > > Zun.
(mit der Aufschrift: „ Vorrede der Articuln des verendcrung dcß miß^ prauchs der kirchen" ,c.), so daß die 21 Glaubens »Artikel unübersetzt geblieben sind. Dieser Umstand spricht dafür, daß auch hier die Ueber setzung der streitigen Artikel längst angefertigt war, bevor man die Vorrede und die Glaubens-Artikel erhielt, und bestätigt unsere obige Annahme von der theilweise» Entstehung der lat. Handschrift in den Regensburger Acten vollkommen. Denn der Schluß des lat. Ter, tes der Regensb urger Handschrift ist in der' Übersetzung wortlich beibehalten: »C. M. V.
Fidelcs et subditj vt sup" sunt memoratj."
Der Uebersetzer mußte also die Namen der Confessoren oben erwarten, und er irrte sich nicht, denn sie standen jedes Falls im ersten Entwürfe der Vorrede. Als nun aber die Vorrede in die Hände der Reaensb. Gesandten kam, erhielten sie dieselbe in ihrer vollendeten Gestalt, wo die Namen aus der Vorrede verschwunden und dafür die Unterschriften am Schlüsse des Ganzen gesetzt waren. So kam es, daß der Ueberse tzer inli-» «crip»! in der Vorrede ganz richtig übersetzte: „Die weil wir hernach verzaichnet.mit Namen in disem libel." Aber er vergaß nun danach den Schluß seiner Übersetzung abzuän dern , wie wir dieselbe Nachlässigkeit auch im lat. Texte dieser Hand schrift zu rügen hatten.' Außerdem erhält auch durch diese Uebersetzung unsere obige Vermuthung von der Entstehung des den Glaubens - Ar tikeln in der lat. Handschrift den Regensb. Acten vorgesetzten Na men-Verzeichnisses der Fürsten und Theologen, welche an dem Mar burg e r Gespräche Antheil genommen haben sollen, ihre volle Bestä tigung , da der Gesellpriester dieses Verzeichniß unübersetzt gelassen hat. Gemeiner meint zwar, dieß habe lediglich seinen Grund in der dem Uebersetzer zur Wicht gemachten Eile; aber er irrt offenbar und jenes Verzeichniß ist augenscheinlich nicht als Schluß der Vorrede, sondern als eine von den Regensburgern selbst ausgegangene histor. Ein-- leitung oder erläuternde Zugabe zu den ihnen mitgetheilten Glaubens - Artikeln zu betrachten, welche als solche den Glaubens - Artikeln selbst vorgesetzt war, also durchaus nicht als Schluß der Vorrede betrachtet werden darf, wie es von Gemeiner geschehen ist. Uebrigens hat Gemeiner außer der Angabe, daß die Uebersetzung den Schluß mit dem lat. Texte dieser Acten gleichlautend habe, sich nicht einmal auf eine sorgfältige Prüfung eingelassen, ob auch wirklich diese Nebersetzung aus demselben lat. Texte hervorgegangen sey. Wir haben diese Mühe nicht gescheut und sind dadurch zu dem Resultate gekommen, daß der Gesellpricster allerdings eine der lat. Handschrift^der Confessio in den Regensb. Acten größten Thcils entsprechenden Text vor sich gehabt
Iun. 46?
yobe, daß aber auch nicht wenige Fälle es wahr-schcinlich machen, daß gerade diese lat. Handschrift sein Original nicht war. Die Beweise für Beides lassen wir unter den Varianten zu unserm Abdrucke des lat. Textes folgen.
Wir sehen nach unfern bisherigen Gegenbemerkungen mit Be< dauern von Gemeiner zuletzt noch den Schluß aussprechen: „ So l, chcm nach behauptet die Bischöflich - Regensburgische Abschrift den Vorzug, unter allen zur Zeit bekann, ten lateinischen Abschriften den echten lat. Text zu enthalten." Wir haben alle seine Nebenbcweise, auf welche er sich diesen Schluß erbaut, bereits widerlegt, müssen aber nun noch auf dieß oft erwähnte Namen l Verzeichnis zurückkommen, von wel, chem Gemeiner bei allen seinen Folgerungen ausgeht. Wer auch nur einigermaßen mit der kirchlichen Geschichte jener Tage bekannt ist, wird es wissen, daß dieses Verzeichniß historisch unwahr ist und von einer mit dem Marburger Gespräche völlig unbekannten Per, son herrühren muß. Es ist sehr auffallend, daß Gemeiner auch nicht den mindesten Zweifel an der historischen Wahrheit dieses Verzeich, nisses hatte und es im Voraus als unbestreitbar richtig annahm. Denn bekanntlich hatte außer dem Landgrafen Philipp von Hessen kein einziger der hier genannten Fürsten an dem Mar bürg er Gespräche im Jahr 1529 Antheil. Man vergl. über das Marburger Gespräch die Berichte Melanchthon' s in der Ulswi-iZ der A. C. (Leipz. 1584. l»I,)S. 96 ff., Luther's Werke, herausgegeben von WaIch XVII. Thcil S, 2352—2378., Bullinger's Nachrichten in Füßli's Beitragen zur, Erläuterung der Hirchenreform,, Geschichte des Schwei, zerlandes III. Theil «A 150—189. (u. Füßli's Vorrede S. 16 bis IM.), Niederer's Nachrichten :c. II. Theil S. 107-124. und IV. Theil S. 414 —442. u. s. w. Und doch spricht Gemeiner S. 14. von Ständen und Gottesgelehrten, welche im Jahr 1529 dem Ge, spräche zu Marburg beigewohnt und daselbst mehrere Glau, bensartikel unterzeichnet haben! Die 15 Glaubens,Ar, tikel sind bekanntlich nur von 10 Theologen unterschrieben. Auch der auffallende Fehler in diesem Namen, Verzeichnisse, daß ein Ste, phan Ngricola Isleben genannt wird, hätte von Gemeiner nicht unbemerkt bleiben sollen. Diese Verwechslung des Augsbur, ger Ngricola mit dem Eisleber Agricola wäre an und für sich schon Grundes genug gewesen, die Authenticität dieses Verzeich, nisses in Zweifel zu ziehen; sie kann nur aus einer großen Unkunde «der die beiden Agricola hervorgegangen seyn und reicht allein hin, dem Verzeichnisse die Originalität abzusprechen. Streicht man übri, gens den Zunamen „Islebe n", so erhalten wir wenigstens für di«
3N«
468 Iun.
Theologen dos lichtige Namen-Verzeichniß und haben dabei die auf, fallende Erscheinung, daß ihre Namen streng in derselben Ordnung fol- gen, in welcher ihre Unterschriften unter deni5Marburger Artikeln gegeben sind. Dieß giebt uns zugleich den Schlüssel zur Entstehung die ses Verzeichnisses selbst; die Namen wurden ohne Zweifel aus irgend einer der vielen schon im I. 1529 erschienenen Ausgaben jener Artikel wörtlich (bis auf jenen Irrthum) entlehnt. Daher finden wir auch natürlich keine größere Vollständigkeit in der Aufzählung dieser Na men, obgleich es in der Überschrift ganz allgemein heißt: „In cli«plii. KI»i-pui-ß, luei-unt"; denn auf der Marburger Disputation waren auch noch andere Theologen als die, welche die 15 Artikel unterschrie- be», wie ?ri«6. M^conil!« und <Ü2»N. «ÜI-licizel-, Giengen «UN die Worte „ >!> <li«puli>!iui,e !VI<»-pui-ß. luerunt" nicht als Ueber-' schrift dem ganzen Namen-Verzeichnisse voran, sondern nur den Na men der zehn Theologen, so hätten wir für die Fürsten und Städte das volle Verzeichniß derjenigen, welche nach allen bekannten Hand, schriften (außer der Dessauischen, welche noch die Namen der vier Städte: Weissenburg, Heilbronn, Kempten und Wins heim hinzufügt) und Drucken Melanchthon's das lat. Exemplar der Confessio unterschrieben haben, wenn gleich zum Theil in einer andern Folge. Und dieser Umstand darf hier nicht au ßer Acht gelassen werden. Wir finden also hier eine Mischung von Wahrem und Falschem, deren Erklärung wir lediglich in einem Miß verständnisse von Seiten der Regens bürg er Gesandtschaft suchen müsse», nicht aber zur Behauptung der Originalität des Textes dieser Handschrift aufstellen dürfen, wie es von Gemeiner geschehen ist. Wir haben schon oben bemerkt, daß wir durch unsere Entgegnungen der Echtheit des Textes bis auf dieses Namen - Verzeichniß in gewisser Beziehung keinen Eintrag thun wollen, und wir können das »ach der Autopsie so wenig, als bei irgend einem andern von uns zu unserm Urkundenbuche benutzten Acten - Volume» aus den Archiven der ver, schicdenen damaligen euangel. Fürsten. Aber so sehr wir auch diese Echtheit anerkennen, so ist damit noch nicht das Geringste dafür ge sagt, daß dieser Text auch derselbe sey, in welchem das lat. Exemplar dem Kaiser am 15. Iun übergeben wurde. Wir erkennen die Echtheit dieses Textes in so fern an, als es fest steht, daß er unmöglich von Seiten der Regensb. Gesandtschaft weder absichtlich, noch unwis sentlich untergeschoben ist; wir erkennen sie in so fern an, als es kei nem Zweifel unterliegt, daß der lat. Text der Confessio bis auf die vielen Versehen des der lat. Sprache nicht mächtigen Schreibers und namentlich bis auf jenes Verzeichniß der Namen wirklich einmal als Original in der Gestalt existirt hat, wie er uns in der Regensb ur<
'Iun. . 469
yer Handschrift erhalten ist; aber diese Handschri/t stammt von einem Origiirale, welches vor der Uebergabe abgefaßt war und die Spuren der letzten Revision des Textes durchaus nicht ün sich trägt. Hier kommen wir auf einen Punkt, wel< chen Gemeiner ganz unberührt gelassen hat, obgleich er gerade der wichtigste von allen ist: wir meinen die kritische Untersuchung des Ter, t«s. Hätte sich Gemeiner damit auch nur einigermaßen befasse» wollen, so würde er gar bald innc geworden seyn, wie, er sich hier in Vermuthungen erschöpft hat, welche der Text dieser Handschrift sclbst schon an und für sich nicht zuläßt. Wir haben nicht nöthig, hier den Beweis dafür zu geben, da Jeder aus den von uns zu dem hier abge« druckten Texte gegebenen Varianten ihn sich leicht selbst bilde» kann, u, wir »erweisen, da der Text meistens mit den Eigenthümlichkeiten des von Nndr. Fabricius in seiner Il^i-mon!« (^»„le«, ^ng. angeb» lich aus dem Originale gedruckten lat. Textes übereinstimmt, auf Weber's'Verzeichniß der Varianten im 1. Theile seiner krit. Gesch. der A. C. S. 100—103., um sein Urthcil über den Text bei Fabri< cius, daß er uns de» ersten Entwurf Melonchthon's giebt, auch für diese Regensburger Handschrift in Anspruch zu nehmen. Wir bemerken nur noch, daß wir die Varianten dieser Handschrift hier unter der Bezeichnung „Reg." gegeben haben. —
Zu dieser Varianten-Sammlung aus den genannten Hand» schriften fügen wir noch die vollständigen Varianten des von Fabri- ci^us a. a. O. abgedruckten Textes, theils weil dadurch das Verhält» niß dieses Textes zu dem der Würzburger und Regcnsburger Handschriften hier zugleich bestimmt gegeben wird, theils weil uns Web er's Collation eine Nachlese übrig gelassen hat. Visweilen wer» den wir auch Gelegenheit haben, von Weber übersehene Varianten der von ihm sogenannten und von uns nochmals verglichenen L<li!i<, 2n,i<i>i2 vom Jahr 1530 anzuzeigen. >
Urkundenbuch zu der Geschichte des Reichstages zu Augsburg (1530), ed. Förstemann, 1833 (Google data) 148, in: Monasterium.net, URL <https://www.monasterium.net/mom/ReichstagAugsburg/6ff53324-6e43-4a65-85f4-29268e9777a5/charter>, accessed 2025-04-20+02:00
The Charter already exists in the choosen Collection
Please wait copying Charter, dialog will close at success